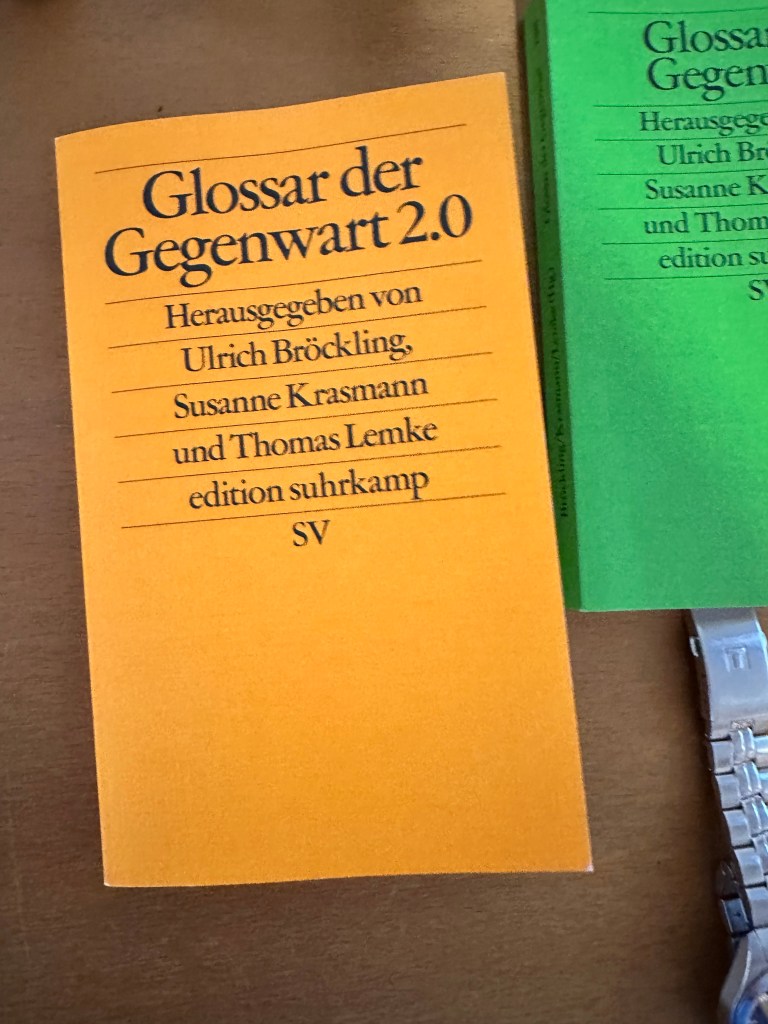Archive for the ‘Politikwissenschaft’ Category
Politisch handeln unter Risiko
In Politikwissenschaft on Januar 8, 2026 at 2:56 pmAktualisierte Rezension (2026)
Herfried Münkler / Matthias Bohlender / Sabine Meurer (Hg.): Handeln unter Risiko – Gestaltungsansätze zwischen Wagnis und Vorsorge. Bielefeld: transcript. ISBN 978-3-8376-1228-8.
„Handeln unter Risiko“ erschien wenige Wochen vor der Katastrophe von Fukushima, die sich am 11. März 2011 in das kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Damals war der Band ein Beitrag zum theoretischen Diskurs über Sicherheit, Vorsorge und Wagnis in modernen Gesellschaften. Heute, im Jahr 2026, lässt er sich auch als historische Momentaufnahme lesen – als Diagnose einer Welt an der Schwelle zur permanenten Krisenerfahrung.
Was Wolfgang Bonß in seinem Beitrag als „(Un)Sicherheit als Problem der Moderne“ beschreibt, hat sich in den Jahren nach Fukushima vielfach bestätigt: Die Versprechen technischer Beherrschbarkeit haben sich als Illusion erwiesen. Tschernobyl und Fukushima waren die paradigmatischen Orte dieser Erkenntnis. Doch seitdem sind neue Risikotopografien hinzugekommen – Pandemien, Cyberangriffe, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Energie- und Klimakrisen. Sie alle verdeutlichen, dass sich die Relation von Risiko und Sicherheit in der globalisierten Moderne nicht mehr stabilisieren lässt.
Die Herausgeber – Herfried Münkler, Matthias Bohlender und Sabine Meurer – haben schon damals das Spannungsverhältnis von Prävention und Nachsorge betont. Ihr Befund gilt unvermindert: Das Präventionsprinzip dominiert, das nachsorgende Prinzip ist diskreditiert. Doch gerade der Verlauf der COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie notwendig gesellschaftliche Resilienz und Nachsorgekapazität sind, wenn Prävention versagt oder an strukturelle Grenzen stößt. Das Konzept des „nachsorgenden Prinzips“ erscheint heute aktueller denn je: als realistische Antwort auf die Unvermeidlichkeit des Risikoeintritts.
Die Beiträge des Bandes wirken aus heutiger Sicht erstaunlich vorausschauend: Sie reichen von Herfried Münklers Überlegungen zu „Sicherheit und Freiheit“ über Ortwin Renns und Marion Dreyers Konzepte der Risk Governance bis zu Harald Welzers „Ökologie des Krieges“ und Heike Kriegers völkerrechtlichen Reflexionen zu einer neuen Sicherheitsarchitektur. Fast prophetisch mutet an, dass Leon Hempel und Michael Carius schon 2011 die innere Sicherheit im „transnationalen Großraum der Europäischen Union“ analysierten – zu einem Zeitpunkt, als man Migrationsdruck, Pandemie-Management oder hybride Bedrohungen noch nicht als sicherheitspolitische Schlüsselthemen begriff.
Auch Friedbert W. Rübs Diagnose der „permanenten Transformation“ des Wohlfahrtsstaats liest sich heute in einem anderen Licht: soziale Unsicherheit und Prekarisierung haben sich seitdem nicht aufgelöst, sondern sind struktureller Bestandteil westlicher Gesellschaften geworden. Rübs These, dass die „Krise“ selbst zur Normalform des Wohlfahrtsstaates geworden ist, hat sich als erschreckend robust erwiesen.
In der Rückschau erscheint Münklers Sammelband wie ein Frühwarnsystem einer Gesellschaft, die an die Dauerpräsenz von Krisen gewöhnt werden sollte. Der homo oeconomicus, dessen Sicherheitsglaube Bonß so präzise seziert, steht heute in Gestalt datengetriebener Kontrollsysteme und algorithmischer Risikoabschätzungen erneut im Zentrum der gesellschaftlichen Steuerung. Die Controller haben das Zepter nicht abgegeben – sie haben es digitalisiert.
„Handeln unter Risiko“ ist damit kein zeitgebundenes Produkt der Nach-Fukushima-Jahre, sondern ein Schlüsselwerk zur Selbstreflexion spätmoderner Gesellschaften geblieben. Es fragt nach den Grenzen von Kontrolle und nach der Zumutbarkeit des Wagnisses – und verweist damit auf eine Einsicht, die 2026 aktueller ist denn je: Sicherheit ist kein Zustand, sondern eine Erzählung, die immer wieder neu ausgehandelt werden muss.
Dr. Armin König
Aufwühlend und eminent wichtig: Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen
In Politikwissenschaft on Dezember 1, 2025 at 10:53 pmFilmkritik
von Dr. Armin König
Seit „Holocaust“ hat mich kein Film über die Nazi-Verbrechen gegen die Menschlichkeit so aufgewühlt wie „Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen“ (2025). Obwohl Regisseur Carsten Gutschmidt ja eigentlich eine Gerichtsreportage über den Beginn und den Verlauf der Nürnberger Prozesse gedreht hat, wurde der Film selbst zu einem höchst persönlichen Drama mit tiefer Intensität – dank außergewöhnlicher schauspielerischer Leistungen.
„Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen“ erzählt die Ereignisse von Nürnberg aus der Perspektive zweier junger Holocaust-Überlebender: Ernst Michel, damals 22 Jahre alt, und Seweryna Szmaglewska, damals 29 Jahre alt.
„Ich habe überlebt. Als Jude. Ich war ein Flüchtigkeitsfehler im System“, sagt der Auschwitz- und Buchenwald-Überlebende Ernst Michel aus Mannheim an einer Stelle eher nebenbei – und trifft gerade damit ins Herz und die Seele der Zuschauenden. Er ist die Hauptperson dieses Dokudramas. Keiner wirkt so authentisch.
Ernst Michel hat seine Familie in der Schoa verloren. Und er hat die perversen Medizinexperimente Josef Mengeles überlebt. Michel musste im KZ junge gesunde Frauen in Mengeles OP-Säle führen, ohne auch nur eine Regung zeigen zu dürfen – und ihre Leichen musste er anschließend abtransportieren. Möglicherweise hat er nur deshalb überlebt, weil er eine schöne Handschrift hatte und im Auftrag der Gaskammermörder die Totenscheine ausstellen musste.
Als Überlebender dieser KZ-Hölle ist er zu der übermenschlichen Herausforderung bereit, über den Prozess im Nürnberger Gerichtssaal 600 zu berichten – und damit auch über die Massenmörder des Naziregimes, die ihm gegenüber im Gerichtssaal sitzen. Seine Artikel zeichnet er mit „Sonderberichterstatter Ernst Michel. Auschwitz-Nummer 104995“.
Mehr als einmal vertraut er, der Reporter-Novize der Deutschen Allgemeinen Nachrichtenagentur (DANA), sich seinem jungen Kollegen Willy Brandt an, der ihm die entscheidenden Hinweise gibt, wie er diesen Prozess als Journalist und als Mensch überstehen und journalistisch herausragend bewältigen kann. Die Rolle Michels ist mit Jonathan Berlin überzeugend besetzt. Gleiches gilt für die Rolle der KZ-Überlebenden Seweryna Szmaglewska, gespielt von Katharina Stark. Sie ist Zeugin der Anklage – eine von nur zwei Frauen, die überhaupt zugelassen werden als Zeuginnen –, wird aber immer wieder hingehalten und vertröstet. Fast glaubt man, sie würde aufgeben und abreisen. Aber sie bleibt. Und sie, die schwer Traumatisierte, die Leidende, die nicht verstehen kann, wie die Verteidiger der Nazigrößen mit Tricks und Winkeladvokatenzügen den Prozess verzögern und in die Länge ziehen, sagt dann doch aus, ebenso wie die Zeugin Marie-Claude Vaillant-Couturier. Sie sagte aus: „In Auschwitz waren acht Verbrennungsöfen. Diese waren aber ab 1944 nicht mehr ausreichend. Die SS ließ von den Häftlingen große Gruben ausgraben, in denen sie mit Benzin übergossenes Reisig anzündeten… Eines Nachts wurden wir durch furchtbare Schreie aufgeweckt. Am nächsten Tag haben wir von Männern, die im Sonderkommando, dem Gaskommando, arbeiteten, erfahren, dass sie am Abend vorher lebendige Kinder in die Scheiterhaufen geworfen hätten, da nicht mehr genügend Gas vorhanden war.“
Das ist schwere Kost, aber notwendig und wichtig. Weil es all die Legenden, die im Nachhinein gestrickt wurden und jetzt wieder neu aufleben, ad absurdum führt.
Und so werden wir anhand einer Montage von dokumentarischen Filmaufnahmen aus dem Prozesssaal und Spielszenen selbst zu Zeugen eines Strafprozesses, wie ihn die Welt zuvor noch nicht gesehen hat. Entsetzt verfolgt man, wie sich die Nazigrößen Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl und Alfred Rosenberg allesamt für „nicht schuldig“ erklären – trotz millionenfacher Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Görings zynische, derbe und gleichzeitig banale Arroganz provoziert noch heute. Wäre dies als fiktionales Drehbuch eingereicht worden, wäre es wohl zurückgewiesen worden. Aber es war die Realität. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem Nürnberger Gerichtssaal sind unbestechliche Dokumente dieser „Banalität des Bösen“ (Hannah Arendt) und der abgrundtiefen Bosheit.
Als jüngster Journalist und einziger Auschwitz-Überlebender unter Reportern aus aller Welt und einziger Auschwitz-Häftling unter den Berichterstattern wird Michel zum wichtigsten Chronisten in Nürnberg. Über die abgrundtiefe Bosheit der Angeklagten, deren Selbstgerechtigkeit, die Langeweile, die den Prozess zeitweise umgibt, muss der 22-jährige Journalist nun täglich schreiben. Er kommt jeden Tag. Es ist seine Mission. Seine Berichte werden weltweit gelesen. Und weil er als „Auschwitz-Häftling Nr.“ trotz erlittener schwerster Ungerechtigkeiten objektiv berichtet, will Göring (in den Spielszenen überzeugend: Francis Fulton-Smith) ihn in seiner Zelle treffen. Görings aalglatter Anwalt Dr. Otto Stahmer (authentisch gespielt von Wotan Wilke Möhring) überredet Michel tatsächlich zu diesem Treffen in der Zelle. Als Göring, Architekt der Judenvernichtung, ihm die Hand reichen will, flieht Michel entsetzt. Faktum und Fiktion in einer nachgestellten Szene.
Ja, das ist zeitweise schwer auszuhalten, auch als Zuschauer.
Der Film müsste in jeder Schule, in jeder Gemeinde gezeigt werden – gerade in Zeiten von Remigrationsfantasien und Hass und Gewalt rechtsextremistischer Fanatiker, „Schuldkult“-Reden der AfD und zunehmender Geschichtsvergessenheit.
Ergänzt werden die Spielszenen des Dokudramas durch Interviews mit Ernst Michels Tochter, die erstmals den Gerichtssaal in Nürnberg besucht, in dem ihr Vater saß, sowie mit Seweryna Szmaglewskas Sohn.
„Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen“ ist ein außerordentlich wichtiger Film, an dem sich alle neun Landesrundfunkanstalten beteiligt haben.
Der NDR schreibt dazu erläuternd auf der Webseite:
„Mit ‚Nürnberg 45‘ präsentiert die ARD eine eindrucksvolle und historisch bedeutsame Produktion, die dokumentarische Genauigkeit mit emotionaler Tiefe verbindet. Den Beteiligten ist es gelungen, die komplexe Gemengelage der unmittelbaren Nachkriegszeit differenziert und mit hoher künstlerischer Qualität darzustellen. Das Dokudrama leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung mit diesem prägenden Kapitel des 20. Jahrhunderts.
‚Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen‘ ist ein Beispiel für die besondere Kraft filmischen Erzählens historischer Stoffe. Das Genre des Dokudramas, das in der ARD eine lange Tradition hat, eignet sich besonders gut, um historische Themen gerade auch für jüngere Zielgruppen lebendig und nachvollziehbar aufzubereiten.“
Dieser Film hat höchste Auszeichnungen verdient.
Cast u. a.:
Jonathan Berlin: Ernst Michel [HR]
Katharina Stark: Seweryna Szmaglewska [HR]
Wotan Wilke Möhring: Dr. Otto Stahmer [NR]
Francis Fulton-Smith: Hermann Göring [NR]
Rony Herman: Bill Stricker [NR]
Max Schimmelpfennig: Witold Wisniewski [NR]
Franz Dinda: Willy Brandt [NR]
Hendrik Heutmann: Stanislaw Piotrowski [NR]
Synchronstimmen (Originalaufnahmen):
Heino Ferch: Ernst Michel
Herbert Knaup: Jacek Wiśniewski
Annette Frier: Lauren Shachar
Drehbuch: Dirk Eisfeld
Literarische Vorlage: Seweryna Szmaglewska, basierend auf dem Roman „Die Unschuldigen in Nürnberg“
Kamera: Jens Boeck
Musik: Jens Südkamp
Produzenten: Michael Souvignier und Till Derenbach
Regisseur: Carsten Gutschmidt
Produktionsfirmen:
Zeitsprung Pictures, Spiegel TV
Erstausstrahlung ARD: 9. November 2025
Uraufführung: 27. September 2025, Filmfest Hamburg.
Ernst Michel änderte später in den USA seinen Namen in Ernest W. Michel.
1993 veröffentlichte er seine Erinnerungen unter dem Titel Promises to keep. One man’s Journey against incredible odds.
Hat kommunale Selbstverwaltung eine Zukunft?
In Politikwissenschaft on November 3, 2025 at 11:13 pmDr. Armin König
Kommunale Selbstverwaltung steht heute stärker denn je unter Druck – zugleich wächst ihre Bedeutung als politisches Labor für die glokale Zukunft. Kommunen sind beides: Krisenbrennglas und Möglichkeitsraum.
Neue Krisensymptome der Kommunen
Kommunale Selbstverwaltung leidet aktuell vor allem unter struktureller Unterfinanzierung, wachsender Aufgabenlast und rechtlicher Verdichtung auf Bundes‑, Landes‑ und EU‑Ebene. Rekorddefizite, Investitionsstaus in dreistelliger Milliardenhöhe und steigende Sozialausgaben engen die Entscheidungsspielräume ein und drohen die verfassungsrechtlich garantierte Autonomie auszuhöhlen.
Kyrill-Alexander Schwarz schreibt dazu auf dem VErfassungsblog:
„Die Krise der kommunalen Selbstverwaltung droht zu einer Krise des demokratischen Verfassungsstaates zu werden, wenn in Folge einer strukturell bedingten finanziellen Notlage die kommunale Ebene zunehmend nicht mehr in der Lage ist, autonom zu verantwortende Entscheidungen zu treffen. Wie drastisch die Lage der Kommunen ist, zeigte zuletzt ein Brandbrief vom 28. Oktober 2025, in dem die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister von 13 Landeshauptstädten eine „Neujustierung der Grundsätze der kommunalen Finanzausstattung“ forderten. Aus finanzverfassungsrechtlicher Perspektive zeigt sich, dass sich die Schwächen der finanziellen Absicherung der Selbstverwaltungsgarantie aus strukturellen Schwächen der Verfassung ergeben.“
https://verfassungsblog.de/kommunen-finanzen-verfassung-haushalte/
Hinzu kommt eine kumulierte Dauerkrise: Migration, Klimaanpassung, Energie‑ und Verkehrswende, Digitalisierung und soziale Spaltung treffen zuerst die lokale Ebene. Kommunen werden zum Vollzugsorgan nationaler und europäischer Politik, ohne stets ausreichend Ressourcen, Personal und Steuerungskompetenz zur Verfügung zu haben.
Auch Rechtspopulismus und Demokratieskepsis rücken in den Fokus: „80 Prozent der Städte stufen sie als (sehr) wichtige Herausforderungen ein“, schreibt das Deutsche Institut für Urbanistik. Stadtspitzen sehen den Umgang mit Rechtspopulismus und politischer Polarisierung inzwischen als zentrale Herausforderung, die eng mit der Finanznot und der als „fremdbestimmt“ empfundenen Aufgabenübertragung verknüpft ist. Wo lokale Politik nur noch „Vollzug“ ist, erodiert die Motivation der Ehrenamtlichen – und die Qualität kommunaler Repräsentation gerät in Gefahr.
Glokale Überforderung und demokratische Erosion
Die Verdichtung globaler Probleme im lokalen Alltag erzeugt ein Spannungsfeld: Kommunen sind Adressat weltpolitischer Konflikte, verfügen aber nur über begrenzte Steuerungsmacht. Steigende Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger kollidieren mit schrumpfenden Budgets, was Frust in Räten, Verwaltungen und Stadtgesellschaft verstärkt.
Selbstverwaltung zwischen Kollaps und Comeback
Die aktuelle Lage lässt sich als paradoxer Doppeltrend beschreiben: Einerseits droht der finanzielle und organisatorische Kollaps, andererseits gewinnen Kommunen als strategische Schlüsselakteure in Klima‑, Migrations‑ und Transformationspolitik an Bedeutung. Ohne leistungsfähige Städte und Gemeinden scheitern nationale Ziele bei Klimaschutz, Infrastruktur und sozialem Zusammenhalt.kommunal+3
Gleichzeitig werden kommunale Handlungsspielräume durch zweckgebundene Förderprogramme und enge Regulierungsmuster weiter verengt. Wer Geld will, muss sich in Bundes‑ und EU‑Logiken einpassen – mit der Folge, dass lokale Prioritäten oft hinter Programmzyklen und Förderkulissen zurückstehen.
Glokale Zukunft als Transformationschance
Trotz aller Krisensymptome entstehen auf lokaler Ebene neue Formen der Politik, in denen globale Herausforderungen mit lokalen Ressourcen verknüpft werden. Kommunale Energiewenden, integrierte Klimaanpassungsstrategien und migrationspolitische Innovationsprojekte zeigen, dass Gemeinden Gestaltungskraft entwickeln können, wenn sie Netzwerke, Zivilgesellschaft und lokale Wirtschaft strategisch einbinden.
Das Leitbild verschiebt sich vom „Machtraum“ zum Kommunikationsraum: Städte und Gemeinden, die Bürgerbeteiligung, digitale Beteiligungsformate und partnerschaftliche Governance ernst nehmen, gewinnen an Resilienz und politischer Legitimation. Sie übersetzen globale Megatrends in konkrete Lebensqualitätsgewinne vor Ort – von klimaresilienten Quartieren bis zu neuen Formen lokaler Daseinsvorsorge.
Allerdings stehen diese Akivitäten unter zunehmendem Druck nicht nur der rechtsextremen AfD, sondern auch von Teilen der Union und der Wirtschaft. Das ist, und das sage ich als langjähriger Bürgermeister, der sich auch überregional immer kritisch positioniert hat, extrem bedenklich.
Bedingungen für eine zukunftsfähige Selbstverwaltung
Damit kommunale Selbstverwaltung im Spannungsfeld des Glokalen Zukunft hat, müssen zentrale Rahmenbedingungen verändert werden. Erforderlich sind eine grundlegend verbesserte, krisenfeste Finanzausstattung, mehr unkonditionierte Investitionsmittel, ein Abbau bürokratischer Hürden sowie eine konsequente Stärkung lokaler Wissens‑, Lern‑ und Beteiligungsstrukturen.
Die Zukunft der Demokratie entscheidet sich in den Kommunen: Gelingt es, sie vom bloßen Vollzugsapparat zur lernenden, offenen und kooperationsfähigen Glokal‑Governance weiterzuentwickeln, kann die kommunale Selbstverwaltung aus der Krise heraus zu einem Motor demokratischer Erneuerung werden.
Literatur
Alber, E. (2014). Die Gemeinde im Europäischen Mehrebenensystem: Auslaufmodell oder» Inkubator «für Innovation?. In Gemeinden im Europäischen Mehrebenensystem: Herausforderungen im 21. Jahrhundert (pp. 9-26). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
Ante, C. (2015). Chancen und Risiken direkter Demokratie : Direktdemokratische Partizipation auf kommunaler Ebene in Deutschland und der Schweiz. Baden-Baden: Nomos.
Barber, B. R. (1994). Starke Demokratie. Über die Teilhabe am Politischen. Hamburg.
Barber, B. (2013). Warum Bürgermeister die Welt regieren sollten. https://www.ted.com/talks/benjamin_barber_why_mayors_should_rule_the_world/transcript?language=de
Brodocz, A., Llanque, M., & Schaal, G. S. (2008). Bedrohungen der Demokratie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Buhmann, M. (2006). Kompetenzorientiertes Management multinationaler Unternehmen : ein Ansatz zur Integration von strategischer und internationaler Managementfoschung. Wiesbaden: DUV.
Castells, M. (2003). Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Stuttgart: UTB.
Dettling, D. (Hrsg.) (2008). Die Zukunft der Bürgergesellschaft. Herausforderungen und Perspektiven für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ; Festschrift für Warnfried Dettling. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Gerhardt, V. (2007). Partizipation: das Prinzip der Politik. München: CH Beck.
Hessel, S. (2011). Empört euch! Berlin: Ullstein.
Hessel, S & Vanderpooten, G. (2011). Engagiert euch! Berlin: Ullstein.
Hill, H. (2005). Kommunale Selbstverwaltung – Zukunfts- oder Auslaufmodell? : Beiträge der 72. Staatswissenschaftlichen Fortbildungstagung vom 24. bis 26. März 2004 an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Berlin : Duncker & Humblot, 2005.
Hoyningen-Huene, P. (1994). Zu Emergenz, Mikro- und Makrodetermination. Lübbe, W.,(Hg.), Kausalität und Zurechnung. Über Verantwortung in komplexen kulturellen Prozessen, Berlin/New York: de Gruyter, 165-195.
König, A, (2011): Bürger und Demographie. Partizipative Entwicklungsplanung für Gemeinden im demographischen Wandel ; Potenziale lokaler Governancestrategien in komplexen kommunalen Veränderungsprozessen. Merzig: Gollenstein.
König, A. (2016). Demographie kompakt 2016. Illingen: Edition Kerpen.
Schwarting, G. (2005). Kommunalpolitik im Zeichen der Globalisierung – oder: Das Ende des Merkantilismus? – Anmerkungen zu einer Strategiedebatte für kommunales Handeln im 21. Jahrhundert. Christian Rosskopf zum 75. Geburtstag. http://www.uni-speyer.de/files/de/Studium/Lehrende/Schwarting/KommunalpolitikimZeichenderGlobalisierung.pdf
Steger, C. O. (2014). Vergleich der Ebenen: Vertrauen in die Gemeinden. In Gemeinden im Europäischen Mehrebenensystem: Herausforderungen im 21. Jahrhundert (pp. 161-176). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
Sterl, B. (2016). Die Europäisierung der Kommunen: zwischen Absorption und Transformation. Baden-Baden: Nomos.
Tausendpfund, M. (2016). Rezension zu: Christian Ante: Chancen und Risiken direkter Demokratie. Baden-Baden: 2015, in: Portal für Politikwissenschaft, http://pw-portal.de/rezension/39464-chancen-und-risiken-direkter-demokratie_48100, veröffentlicht am 25.02.2016.
Taleb, N. N. (2015). Der schwarze Schwan: die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Albrecht Knaus Verlag.
Welzer, H., Giesecke, D., & Thürauf, L. (Hrsg.). (2014). Der FUTURZWEI Zukunftsalmanach 2015/16. Fischer Taschenbuch.
Wollmann, H. (2013). Stadt im Blick der Kommunalwissenschaft. In Stadt : ein interdiszipliniäres Handbuch. (pp. 174-184). JB Metzler.
Wollmann, H. (2002). Die traditionelle deutsche kommunale Selbstverwaltung – ein Auslaufmodell? Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften I: 24–51.
Anmerkungen zum Literaturland Saarland
In Politikwissenschaft on Oktober 23, 2025 at 12:01 amDr. Armin König
Vortrag in der Buchhandlung Bock und Seip
Herzlich willkommen zu dieser Reise durchs verwinkelte Literaturland Saar, wo wir von Weltliteratur bis zum Saar-Krimi, von der lyrischen Offenbarung bis zur Slampoetry, vom Thriller bis zum Liebesroman alles finden.
Da kreucht und fleucht allerlei Getier und Gefährt, derweil wir beim Blick durchs Teleskop Luggel Harigs Luftkutscher und Hans Arnfrid Astels Sternbilder entdecken, den Varuswald und Johannes Kühns Schaumbergring, Chinesen, die in Frank P. Meyers Dorf Bundeskegelbahn und Weinberge kaufen, das Gasthaus Zeggels in Primstal als kleines Widerstandsnest à la sarroise, Pfälzer, viele Franzosen, Leidinger, Schwimmer in fremdem Gewässer und sogar Tiger im Dorf. Dem Opa ist schon der Galgen aufgebaut, wenn auch am Krankenhausbett von Martin Bettinger, und während Jürgen Albers den Kleinen japanischen Großmeister ins Nirwana reisen lässt, weiß Astel, wohin der Hase läuft. Alfred Gulden, der einst geradewegs vom Großen Markt in Saarlouis zu den Silver Towers nach New York flog, diesen überdimensionalen hochkant gestellten brutalistischen Streichholzschachteln, treibt nun nur noch Schnecken nach Metz.
In Felicitas Frischmuths Damra bei St. Wendel wohnt schon lange keiner mehr, und auch die Katakomben unter der Höllischen Illinger Wurstfabrik sind verlassen und dienen nur noch Krimiautoren als Gespensterort.
Zum Glück haben sich einige Dichter auf der einzigen Lyrikwand des Saarlandes in der Illipse verewigt, darunter auch ein reimfreier Bürgermeister, der neben Harig und Jandl seine Ballade vom Zwiebelturm auf Glasscheiben schrieb, und in den Kellern des Bücherturms an der Uni lagern im Archiv zigtausende Blätter und Manuskripte saarländischer Provenienz, die noch längst nicht erschlossen und analysiert sind. Wahre Schätze sind darunter. Womöglich bleiben sie auf immer und ewig geheimnisvoll und verschlossen. Aber wenn Sie bei Archivar Hermann Gätje nachfragen, werden Sie einen Schlüssel und einen Schreibtisch zum stöbern bekommen
Mehr als 130 Autorinnen und Autoren finden sich auf meiner Liste, und es ist völlig illusorisch, sie auch nur alle zu nennen heute abend. Ich entschuldige mich also vorsorglich bei allen Nicht-Genannten.
Und eigentlich müssten wir die wichtigsten Übersetzer auch noch aufnehmen, also Eugen Helmlé, Svenja Becker und Lothar Quinkenstein.
Helmlé ist schon lange eine deutsch-französische Institution, Svenja übersetzt regelmäßig die Bestseller- und Starautorin Isabel Allende und Quinkenstein, der Quierschieder, die polnische Nobelpreisträgerin Olga Tokarzcuk. Was wären die Heldinnen der Weltliteratur auf dem deutschen Markt ohne ihre Übertragung in verständliches Deutsch?
Den Lothar kenne ich natürlich auch, weil der in Illingen an meinem Gymnasium Abitur und nebenan in der Schülerkneipe Deckel gemacht hat. Wie wir alle. Und weil er so großartige Essays schreibt.
Wie und wo also anfangen?
Und wie kriegen wir’s hin, dass wir nicht nur oder gerade nicht an die Helden von einst – Gustav Regler, Maria Croon, Johannes Kirschweng, Ludwig Harig und Johannes Kühn – erinnern, sondern auch an die eher unbekannten Modernen?
Wir reisen mit einem VW Bulli durchs Tatort-Land und lassen den lieben Gott einen guten Mann oder eine gute Frau sein. Das ist die wahre saarländische Freude, und wem das nicht genügt, dem verschreiben wir Sprechstunden für die deutsch-französische Verständigung. Olaf Scholz wäre so ein Kandidat für diese Sprechstunden gewesen. Aber die Ampel ist aus, Scholz sitzt auf Hinterbänken. Nun merzt und klingbeilt die Politik rauer und ebenso holprig wie die Ampel, aber vielleicht ist sie trotzdem nicht schlechter für uns Saarländerinnen und Saarländer.
Friedrich Merz und Frank Walter Steinmeier haben mitsamt ihren Frauen nämlich zusammen mit Anke Rehlinger den wahren Arzt in kulinarischer deutsch-französischer Verständigung genossen – und die Rezepte ihres Lebens erhalten, die durch den Magen gingen bei Christian Bau in Perl. Und es ward kein Perl-Huhn gereicht, aber das ist eine andere Geschichte.
Es ist: Schönes Leben. Um Ulrike Kolbs Roman schon mal zu zitieren, dessen Cover das alte Korns Eck in Saarbrücken ziert, wenn sich noch jemand daran erinnern kann. Es war ja hier ganz in der Nähe, nur wenige 100 Meter entfernt. Nach Saarbrücken kommen wir später. Und nach Fenne auch.
Starten wir im Herzen des Gärtchens, wo das Saarland am erhabensten ist:
Auf dem Schaumberg in Tholey, wo Johannes Kühn seine Wanderkreise zog und wo das Wortsegel kündet: Hier hat ein Dichter gelebt.
„Und hab am Gras mein Leben gemessen“ heißt ein Gedicht-Band Kühns, der 2014 bei Hanser erschienen und noch lieferbar ist. Hard-Cover, sehr edel und schön gestaltet. Den möchte ich Ihnen ans Herz und die Brust legen.
Es ist eine ziemlich sentimentale, aber schöne Lyriksammlung, altersweise, die belegt, warum Kühn einer der bedeutendsten Dichter Deutschlands ist.
Trinken wir also zu Beginn unserer Saarlandreise einen Morgenkaffee bei Kühn.
Kaffee
Der Kaffee duftet.
Flott hat ihn die Kellnerin gebraut und flott kredenzt.
Ich trink.
Er bringt das leise Fieber,
das ich zu meinen
Versen brauche.
Ich danke herzlich,
ich zahle gern.
Ich sitze oft an diesem Tisch
zu Wald und Wiese hin.
Es taucht der Falk herab.
Die Wolke schenkt der Tauben mildes Bild.
Der Frühling zieht sich an
zu einem landesweiten Ausgang,
ob er mich ruft als einen seiner Freunde,
mit dem schwarzen Trunk
bin ich begeistert
vom nahen Weiher, seinem Spiegel.
Und noch ein kleines kühnes Gedicht
Nature-Writing pur – Naturlyrik auf modernste Art, bei Kühn schon immer auf höchstem Level:
Tänzerin
Auf einer Lichtung allein ist die Birke
Mit flirrendem Zweighaar
Tänzerin.
Es geigt der Wind für sie.
Manchmal fliegt ein Fink auf ihr Haupt
Und löst die Geige ab.
Der Vogel tröstet sie,
wenn sie ermüdet ist.
Den Wechsel,
das Spiel erleb ich gern.
Nach einer kurzen Rast auf der Schaumberg-Alm, wo wir uns laben, besteigen wir den legendären T-1-Bully, mit dem uns Frank P. Meyer ins nahegelegene Primstal chauffiert – ins Gasthaus Zeggels. Dort treffen wir vielleicht die Rückbanks-Elfi, Hecks Hannes, die schöne Johanna, Fluchtfahrer Speedy und die Engel Gabriel und Raffi, die beim legendären Überfall auf die Mensa der Uni Trier ein Vermögen gemacht hatten – und ganz nebenbei noch einen vergrabenen Schatz in Opas Hof gefunden hatten. Da ist ein neuer Harig unterwegs, ein sehr moderner, ein polyglotter Chronist der 1960er bis 2020er Jahre. Genau das hat uns im Saarland gefehlt.
Der Frank hat so viel zu erzählen im Bully und in Zeggels – wie einst Grimmelshausen, mit Witz und Charme und perfekter saarländisch-hochdeutsch-flämisch-englischer Sprachbeherrschung – vom legendären Mariathlon-Wettbewerb über einen toten Chinesen auf der Kegelbahn, von 60er- und 70er Jahre-Schallplatten, von CDs, von Zigaretten-, Benzin- und Schnaps-Schmuggelfahrten nach Luxemburg, die wir auch gemacht haben, von Gabriel, der über das Bergwerksunglück von Luisenthal 1962 schreibt, von Partys, Trinkgelagen und einem Bengel namens Rafael, der als Pizza-Entwickler bei Tiefkühl-Wagner in Braunshausen anheuert und mit dem das ganze Desaster erst anfängt.
„Normal passiert da nichts“, heißt der Roman. Aber das ist nun wirklich mächtig untertrieben. Da sprüht ein Autor vor Ideen, Regie-Einfällen und Sprachspielen. Es war das erste Mal, dass Meyer hier sein großes Erzähltalent zeigte, und ich habe ihm damals bei einer Lesung in der Illinger Burg gesagt: Das musst du weitermachen. Und er hat.
Stoff ist da – mehr als genug. Damals wie heute.
Es gab noch Grenzübergänge, aber die sind ja jetzt damk Dobrindt und Merz auch wieder da. In Richtung Frankreich, Luxemburg und über die Eifel nach Belgien. Und wer die alten Schmuggel- Kaffee-, Tank- und Zigarettenrouten nach Luxemburg kennt – über Remich oder Schengen -, der weiß, dass man von dort die Türme von Cattenom sieht.
Ah: Ein Motiv. Nicht nur für Fotografen. Auch für Prosa-Autoren. Und was für eins. Atom. Müll. Gau. Saar.
Eigentlich ist es selbst von Zeggels im Herzen von Primstal nicht weit nach Cattenom, wo in »Hammelzauber« ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist, aber Primstal ist doch weit genug entfernt, um außerhalb der verseuchten Sperrzone zu liegen. Wir blicken in die Zeitmaschine. „Das Saarland in nicht allzuferner Zukunft. Nach einer Kernschmelze im Atomkraftwerk Cattenom sind weite Teile des Saarlandes noch immer unbewohnbar. Aber ein Dorf bleibt stur und dort, wo es schon immer war: Primstal. Seine Bewohner erklären den Ort am Rande der Sperrzone zum gemütlichsten Wartesaal Gottes, in dem der Hammelzauber und das Rollator-Rennen zur Dorfkirmes die Höhepunkte des Jahres bilden. Aber zuvor »war es sonderbar still auf dem Kirmesplatz. Vielleicht weil die Szene wie eine Invasion von Aliens aussah. Oder weil sich die Leute an die Tage nach dem GAU erinnert fühlten.« Und das im Saarland und wir wussten bisher gar nichts davon.
Eigentlich passiert da nichts, das wissen wir aus dem ersten Roman. Doch in der ersten Kirmesnacht werden zwölf absonderliche Straftaten verübt. Die Saarbrücker Kommissarin Paula Lück muss vor Ort ermitteln, und der Einzige, der ihr dabei wirklich helfen kann, ist ein alter Primstaler. Und um alte Geschichten und einen alten VW-Bus geht es auch im neuesten Roman »zweieinhalb Kilometer«. Sie ahnen: Es ist ein Road-Movie, ein saarländisches Road-Movie rund um den Schaumberg mit einem geheimen Paket in einem geheimen Versteck. Und wir wissen nicht, was in diesem in Zeitungspapier eingewickelten Paket drin ist: Hasch? Geld? Papiere? Lesen Sie dieses abenteuerliche Meyer-Stück, das wie immer bei Conte erschienen ist.
Und weil wir es durchaus mit wilden Kerlen und großen Tieren aufnehmen, fahren wir vom Schaumberg über Dirmingen ins nahe Illingen, wo Katja Bohlander-Sahner schreibt: »Vom Schwimmen in fremden Gewässern«. Und »Im Dorf, da wohnen Tiger«, erfahren wir. Vermutlich sind es die Tiger von Hirzweiler. Erschienen in der Edition Schaumberg. Es war ihr Erstling, zunächst noch im Self-Publishing gedruckt. Es ist eine Familiensaga, die von Hirzweiler, Illingen und Mainzweiler bis nach Afrika führt, einmal auch in die Neunkircher Partnerstadt Vlissingen in Zeeland. Es geht um eheliche und uneheliche Kinder, vermeintliche Affären, Eifersucht, große Familiengeheimnisse und sehr unterschiedliche Charaktere. Ein bisschen holprig an manchen Stellen, aber als Lokalmatador konnte ich das verschmerzen. Und die Geschichte ist auch sehr weltfraulich geschrieben.
Ein anderer Illinger ist dafür umso präziser: Lothar Quinkenstein.
Das heißt: Er ist gebürtiger Bayreuther, lebt in Berlin, war auch Quierschieder und Abiturient am Illtal-Gymnasium in Illingen und hat mehrere Jahre in Polen gelebt und unterrichtet, unter anderem in Mielec, in Poznán und Słubice.
Und so wurde er auch zum literarischen Übersetzer für Henryk Grynberg und schließlich für – Olga Tokarczuk. Dass Tokarczuk mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, dazu haben ganz gewiss auch die Übersetzer beigetragen. Lothar Quinkenstein ist einer der Wichtigsten von ihnen, neben Esther Kinsky. Quinkenstein hat Tokarczuks »Jakobsbücher« übersetzt, »Die verlorene Seele«, »Die grünen Kinder« und »Übungen im Fremdsein«. Womit auch sein schriftstellerisches und biografisches Wirken hervorragend umrissen ist.
Quinkenstein hat aber auch selbst wunderschöne Lyrik geschrieben, Essays, unter anderem über die Wahrnehmung Polens und Mitteleuropas und west-östliche Asymmetrien des Gedächtnisses“. Und Archivarbeit für vergessene jüdische Autorinnen und Autoren hat er mit seinen Memorials auch geleistet. Sein Essaybuch »Erinnerung an Klara Blum« hat mich geradezu umgehauen. Sehr klug, wie Schlögel. Einer, der Polen hervorragend kennt. Und die jüdische Geschichte.
Sein charmantestes Werk aber ist »Deckelmacher« über die Illinger Kneipen- und Musikszene. Man weiß als Besucher des Funny Ill sofort, wer gemeint ist.
Lesen Sie also unbedingt Olga Tokarczuk und freuen Sie sich über die präzise Übersetzungsarbeit von Lothar Quinkenstein.
Unsere nächste Station ist Sulzbach, und das hat Gründe.
Natürlich MUSS in einer Reise durch die Literaturszene Saar Ludwig Harig prominent erscheinen, denn er ist aktueller denn je. Meine erste Begegnung mit seinen Büchern hatte ich als Schüler: mit der Romanbiografie Rousseau. Das größte Vergnügen hatte ich mit dem Kleinen Brixius und der Saarländischen Freude.
Heute aber will ich Ihnen ein Buch ans Herz legen, das aktueller denn je ist:
»Wer mit den Wölfen heult wird Wolf«.
Ich weiß noch, wie ich atemlos die ersten Seiten las, die so abenteuerlich mit einer Flucht von Schwäbisch Gmünd nach Hülen begann – und vor allem: mit Schnecken.
»Wie kommt es, dass ich zum erstenmal in meinem Leben Zeit und Geduld habe, so genau die Gestalt einer Schnecke anzuschauen – und nicht aufspringe, Kommandos zu befolgen, mich in Reih und Glied zu stellen, anzutreten in Marschkolonne«.
Daa fängt ja gut an, dachte ich. Flucht vor Amerikanern, Sprung aus dem Eisenbahnwagen, Schnecken. Idylle.
Man denkt schon: Kommt da wieder eine Harigsche Luftkutscherei, doch dann packt er das große Besteck des Romanautors aus, den Verfremdungseffekt, die Geschichte in der Geschichte, den Hammer, indem er eine völlig aus dem Ruder gelaufene VHS-Lesung mit einem kritischen Lehrer zu eben diesem Romananfang mit den Schnecken einschiebt. Und dort wird es dann sehr ungemütlich, sehr politisch, sehr heutig auch, obwohl 1996 geschrieben – also wenige Jahre nach dem Fall der Mauer, dem Ende der DDR, der Implosion des Sozialismus.
Ich zitiere:
„Wir waren frei, doch ich hätte nicht gedacht, daß die Freiheit etwas so Banales sein würde, erzählte ich fünfundvierzigJahre später: Immer, wenn ich das Wort Freiheit höre, denke ich an unbekümmertes Liegen im Gras. Mir ist dieses sorglose Hingestrecktsein so eng mit dem Gefühl der Freiheit verbunden, daß mir jeder Satz, in dem die Freiheit als großes Wort auftönt, schal und oft lächerlich klingt. »Wenn das alles gewesen sein soll, dann war es ein schmählicher Anfang«, sagte ein junger Lehrer zu mir, »Sie würden besser die Fühler einziehen und sich schleunigst in Ihr Schneckenhaus verkriechen.«
An diesem Sonntagmorgen im Mai 1945 ist der Krieg für mich zu Ende, die deutsche Armee besiegt, das tausendjährige Reich zusammengebrochen. Einen Tag später unterschreibt Generaloberst Jodl in Reims die Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Schutt und Asche bedecken das Land.
»Aber der Glaube an eine Idee stirbt doch nicht mir nichts, dir nichts, wenn ein Krieg verlorengeht, eine Gewaltherrschaft entmachtet, ein ideologisch gefestigtes System gestürzt wird«, beharrte der Lehrer auf seiner Ansicht.
Er stand vor mir, hochrot im Gesicht wie ein bis aufs Blut gereizter Puter, und fuhr mich mit laut erhobener Stimme an:
»Sie als überzeugter Hitlerjunge haben doch an diesen Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts geglaubt. Oder nicht? Jedenfalls haben Sie es uns in einem langen Roman allzu feinsinnig und wortreich weismachen wollen. Und dann dieses Ende? Und dieser lächerliche Neuanfang mit Geigen am Himmel und Schnecken im Gras? Das nimmt Ihnen doch niemand auf der Welt ab!«
Der Lehrer schaute sich um, alle vierunddreißig Zuhörer in der Bücherei einer west- deutschen Volkshochschule nickten mit dem Kopf, verzogen ihre Mienen, einige applaudierten sogar.
Ich wußte: Es war vergeblich, das entscheidende Erlebnis eines Augenblicks für andere herbeizuwünschen. Ich schwieg. Ein paar erklärende Worte, die sich aus meinem Kopf drängten, sprangen mir auf die Zunge, ballten sich zwischen den Zähnen, blähten sich auf, doch ich war nicht imstande, den Mund zu öffnen. Mir war, als schwölle der Wörterbrei in meinem Mund zu einer Blase an.
»Sagen Sie lieber nichts!« rief der Lehrer, stieß mit spitzer Stimme in meine Wortblase hinein und fügte hämisch hinzu: »Was jetzt aus Ihrem Mund kommen würde, wäre nichts als leere Luft.«
Mein Schweigen hielt an. Ich schloß die Augen und versuchte, mich an mein Erlebnis von damals zurückzuerinnern. Ich wußte, daß ich meinem Gedächtnis trauen konnte, doch ich war außerstande, mehr zu sagen, als ich schon erzählt hatte, und es kränkte mich der Vorwurf des Lehrers, mein Erlebnis am Waldrand von Hülen sei nichts als der trügerische Streich meiner Erinnerung. Ich schwieg beharrlich weiter. Doch daß ich mich zurückhielt, machte den Lehrer dreister. »Entweder sind Sie ein oberflächlicher Mensch, an dem alles abläuft wie an einer Regenhaut, oder Sie sind ein Lügner, ein raffinierter Provokateur, der seinen Lesern eine sentimentale Damaskusgeschichte auftischt, eine Bekehrung aus heiterem Himmel, in welcher der böse Saulus zum frommen Paulus wird«, wetterte er und attackierte mich mit schamlosen Vorwürfen. »So plötzlich, wie Sie es vorgeben, erlebt keiner seine innere Umkehr«, rief er mit kalter Verachtung in der Stimme, »so rasch wird man kein anderer Mensch. Und merken Sie sich das eine: Denken Sie nicht nur an Ihre eigene Verführung im Nationalsozialismus, denken Sie auch daran, daß sechzehn Millionen Deutsche vierzig Jahre lang im Sozialismus gelebt haben – und wir verlangen von ihnen ja auch nicht, ihren Glauben an eine bessere Welt wegzuwerfen, ohne mit der Wimper zu zucken.« Er sprach von notwendigen Zweifeln und Zusammenbrüchen, philosophierte über beglaubigte Reue und reinigende Sühne, klamüserte in umständlichen Beweisführungen an der Feststellung herum, zwölf Jahre Nationalsozialismus müßten doch in einer jungen Seele ebenso tiefe Spuren hinterlassen haben wie vierzig Jahre Realer Sozialismus in der Seele eines jungen Kommunisten. »Niemand wirft zwölf Jahre, geschweige denn vierzig einfach weg, so als sei nichts gewesen!« rief er aus.
Es klang einleuchtend, ja überzeugend, und die Volkshochschüler applaudierten wieder. Warum redete dieser Mensch in der gleichen Sprache, die ich zwölf Jahre lang gehört habe? Warum führte er die gleichen Waffen ins Feld wie alle besserwisserischen Inhaber und Nutznießer der Wahrheit, seien es Priester oder Parteiführer? Ich verstand wohl, was dieser begabte Demagoge mir erklären wollte, doch leider gibt es für seine Deutungsversuche nicht mehr zu erzählen als diese banale Hülener Geschichte. Die kitschigen Geigen und die harmlosen Schnecken hatten mehr bewirkt als alle spitzfindigen Argumente. Wie schön wäre es fürs Erzählen, hätten mich Zweifel gequält und Zusammenbrüche erschüttert, wie ergiebig wäre es, hätten mich Reue gepackt und Sühne gepeinigt. Ich könnte von schlaflosen Nächten und bitterbösen Träumen, von herzzerreißender Gewissenserforschung und tränenreicher Trauer erzählen, könnte mit ergreifenden Episoden rühren und mit tiefsinnigen Betrachtungen überzeugen und dafür Lob und Anerkennung ernten – muß aber um der Wahrheit willen bei meiner Geschichte bleiben. An jenem Tag am Waldrand von Hülen war ich frei von Zwang und Gewalt, doch nicht frei von Schuld.
Und als ich mich später fragte, ob ich nicht schuld daran habe, daß der kleine René, mein Banknachbar aus der ersten Klasse, ausbrechen mußte aus Reih und Glied und im Waisenhaus verdarb, daß der arbeitsscheue Querulant aus unserer Straße im KZ verschwand und die Peitsche zu spüren bekam – mußte ich mir eingestehen: Auch ich hatte, ein Jugendlicher schon, meine Finger im Spiel, ich lauschte den verführerischen Parolen und folgte ihnen, schläferte mein Gewissen ein und spielte auf meine Weise mit. Nein, ich kann nichts ungeschehen machen.
Aber mir ist nicht geglaubt worden. Also muß ich von vorne anfangen.“
(Harig, Wer mit den Wölfen heult, wird Wolf, 1996, S. 9-11)
»Harig schafft es, einen Spannungsbogen zu schlagen, der die kultivierte Miefigkeit des Übergangs von der Kriegs- zur Nachkriegszeit spüren lässt. Um so mehr gewinnt sein Erzählen an Glaubwürdigkeit. Denn wie die meisten seiner Generation war auch Harig kein Widerstandskämpfer. … Harig war ein begeisterter Hitlerjunge, dem es ungemein schwerfiel, sich auf die neue Zeit einzustellen. Wie andere erkannte auch er, dass Überzeugungen bei einem Systemwechsel nichts mehr bedeuten. Und jene, die früher als stramme Nazis stramme Durchhalteparolen klopften, klopfen jetzt mit Erfolg die Sprüche der Demokratie. Insofern ist das Titelwort, das Harig bei Dolf Sternberger entliehen hat, gut gewählt: »Wer mit den Wölfen heult, wird Wolf.«
(Wolf Scheller, Nürnberger Nachrichten, 30.8.96)
Und wenn wir dann die Nachrichten sehen, die Sprüche hören von Law and Order, wenn wir den Chor der Lemminge verfolgen, die den Sätzen der Demagogen blind folgen und sie verteidigen, dann staunen wir, wie schnell die Masse doch verführbar ist.
Und genau deshalb will ich Harigs Werke unbedingt empfehlen. Von den Verführungen der Nazis bis zu den Nachkriegsfreiheiten des Jazz, der Liebe, der Lust am guten Leben und der guten Sprache bis zu experimentellen Gedichten und glorreich-albernen Überhöhungen der saarländischen Freude ist alles drin. Nur dass wir das Gefühl haben, dass von dieser Luftkutscherei und den Freuden des gemeinsamen europäischen Marktes in diesen harten Zeiten wenig übriggeblieben ist, in denen allzu leichtfertig wieder von Krieg und Kriegstüchtigkeit die Rede ist.
Und so fahren wir weiter in den Saar-Pfalz-Kreis., Wir nehmen hinter Neunkirchen die Autobahnabfahrt Limbach, wo Marcus Imbsweiler aufgewachsen ist. Geboren ist er übrigens in Saarbrücken,. Auf seiner Homepage lesen wir:
»Anfänge
2. Juni 1967. Kindheit im saarländischen Limbach. Moppelig
Schule
Latein. Im Abi Mathe und Physik. Musik nur Grundkurs
Zivi
20 Monate Hirntumore und Bandscheibenvorfälle
Studium
lange vor „Bologna“ oder „Pisa“ in Tübingen und Heidelberg. Philosophie, Geschichte, Musikwissenschaft, Germanistik
Magister
Alfred Andersch, dann Arbeit als freiberuflicher Musikredakteur“
Auch wenn er nun in Heidelberg lebt, gilt er für uns als Saarländer. Schließlich hat er mit »55« einen echt saarländischen Roman geschrieben, der mich ähnlich fasziniert hat, wie Ludwig Harigs Trilogie. Es geht um die Volksabstimmung 1955.
Ums Saar-Statut.
Um fanatisierte Massen.
Um Bedrohung von Politikern.
Um die Störung von Parteiveranstaltungen durch rechtsextreme Politiker, die früher Nazis waren und nun als deutsche Demokraten auftreten.
Heinrich Schneider ist der Prominenteste. Vorsitzender der DPS – Deutsche Partei Saar –, die später FDP/DPS Saar hieß.
Doch doch, der FDP-Held war ein lupenreiner Nazi. Schriftleiter und Gausprecher. Zusammen mit Paul Simonis und Richard Becker war er einer der schärfsten Propagandisten für ein Nein zum Saarstatut und eine Rückkehr des Saarlandes zur Bundesrepublik. Dabei hatte die Propaganda von Heini Schneider und Co durchaus Goebbelssches Format.
70 Jahre ist das jetzt her. Genau 70 Jahre. Man vergisst so schnell.
»Rauchgeschwängert ist die Luft in der Krone«, so beginnt das Kapitel über die Rede des Dr. Schneider. Und es gefriert einem das Blut, wenn man liest, was Imbsweiler schreibt:
»Der DPS-Mann tritt ans Rednerpult. Stattliche Figur, das Haar nach hinten gekämmt. Langer Blick durch die Rauchschlieren des Saals. Kunstpause. Dann: »Deutsche Manner und Frauen!« Großer Applaus.
»Kennt ihr«, ruft der Doktor in die verebbende Begeisterung hinein, »den Unterschied zwischen Marokko und dem Saarland?« Gelächter.
»Was für’n Unterschied?«, melden sich ein paar.
Gelächter.
Der Redner wartet, bis wieder Ruhe einkehrt. Also? »Ein einziger Buchstabe«, erklärt er schließlich. »Auf den Autokennzeichen in Marokko steht OA, bei uns OE. Occupation en Afrique dort, Occupation en Europe hier.«
»Den kannte ich noch nicht«, zischt Kurt seinem Freund durch Beifall und Pfiffe zu. »Und was«, fährt der Doktor fort, »ist der Unterschied zwischen Joho und dem Franken? Na? Ganz einfach, ihr Leut: keiner. Beide fallen!« Wieder Heiterkeit.
»Der
Dicke muss weg!«, schallt es durch den Saal.
Und so ist die Rede des Dr. Heinrich Schneider kein Monolog vor ergebener Zuhörerschaft, sondern eine gemeinsame Darbietung aller. Von Vorsänger und Chor. Der Doktor setzt die Pointen, das Publikum applaudiert. Er fragt – es antwortet. Er macht Pausen – und lässt sie füllen. Als neutraler Zuhörer (einmal angenommen, es gebe einen solchen) hat man weniger das Gefühl, einem Redner zu lauschen als einem Psychologen, der die eigenen unterdrückten Wünsche und Gefühle artikuliert.
»Unsere Gruben werden von Frankreich ausgebeutet«, ruft der Doktor. »Unsere Banken sind in französischer Hand. Unsere Steuergroschen dienen zur Finanzierung der Besatzungsmacht. Ich sage:
Was Moskau für Ost-Berlin, ist Paris für das Saarland.«
Begeisterte Zustimmung.
»Die deutsche Wiedervereinigung muss vom Saargebiet aus ihren Anfang nehmen!«
Dito.
»Was nun die Separatisten angeht …«
»Aufhängen!«, grölt einer.
Tadelnd schüttelt der Doktor den Kopf. »Immer besonnen bleiben, Freunde. Am 23. Oktober hat es sich ausjohot. Schaut euch die Versammlungen der Separatisten an. Kein Hahn kräht mehr nach denen! Würden sie ihre Claqueure nicht in Omnibussen ankarren, müssten sie vor leeren Reihen sprechen. Nein, Moment!«, unterbricht er sich, scheinbar indigniert ob seiner eigenen Vergesslichkeit. »Da sind ja noch die vielen Leibwächter und Spitzel und Hector-Polizisten. Wenn der Ministerpräsident auftritt, ist alles für seine Sicherheit getan, das kann ich euch versichern. Alles.« Kurze Pause.
»Selbst die Toilette lässt er von sieben Gendarmen bewachen.« Das Publikum explodiert förmlich vor Gelächter.
»Aber darüber berichtet Radio Saarbrücken natürlich nichts …«
»Lügensender!«
»Oder die Saarbrücker Zeitung …«
»Lügenpresse.«
»Die sich beide in der Hand der Separatisten befinden. Beziehungsweise der Franzosen. Stattdessen liest und hört man dort immer nur das eine: dass wir, die wir zum NEIN aufrufen, alles Nazis sind.«
Er wartet ab, bis sich das gellende Pfeifkonzert gelegt hat, das diesen Worten folgt. Dann beugt er sich vor, lächelnd, sogar sehr lächelnd, um in vertraulichem Ton zu fragen: »Und soll ich euch etwas verraten? Soll ich es euch verraten, meine Freunde?« Er wartet, blickt sich im Saal um. Erwartungsvolle Spannung liegt auf den Gesichtern. »Wir«, sagt er, lehnt sich zurück und breitet die Arme aus, »wir sind ja auch alle Nazis!«
Für einen kurzen Moment herrscht Totenstille. Ein Loch aus Entsetzen und Unverständnis, in den Saal gebrannt. Aber da sind ja noch die Gesten des Doktors, die ausgebreiteten Arme, sein Schmunzeln, das verschwörerische Augenzwinkern. Ach so! So hat er das gemeint. So! Dann sind wir eben alle Nazis. Hauptsache, wir sind es gemeinsam.
Der Applaus will gar nicht mehr enden.
Kurt und Fred klatschen ebenfalls. Wechseln Blicke. Der traut sich was, der Doktor! Parteimitglied der ersten Stunde, der allerersten, später kaltgestellt, warum, weiß keiner so genau. Freds Blicke wandern zu den Plakaten an den Wänden. Der DPS-Adler, kalt und schwarz wie der des Tausendjährigen Reichs. Gestaltet vom Nazi- Grafiker Müller. Der die Wehrmacht nach Osten peitschte: Gnade und Ehre ist es, Deutscher zu sein. Andere von Herbert Schweitzer, Kampfname Mjölnir. Die deutsche Mutter, das kindesängstliche Saarland: Heim zu Dir! – wie 1935 schon.
War es nicht der Doktor, fragt sich Fred, war es nicht Rechtsanwalt Heini Schneider aus Saarbrücken, der 1933 gefordert hatte, die Gewerkschaften an der Saar zu zerschlagen? Schneider, der Sozialistenfresser? Musik reißt ihn aus seinen Gedanken. Der Doktor ist fertig. Seine Rede endet mit dem gemeinsamen Singen der deutschen Nationalhymne.
Die erste Strophe, im Stehen.
Einige heben den Arm zum deutschen Gruß. Auch Fred und Kurt singen mit. Aus vollem Hals.«
Gerade in diesen Tagen: topaktuell. Und so ganz anders als die offizielle Geschichte.
Aber wenn Sie im Internet mal etwas ganz Schräges zum Saarland lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen Marcus Imbsweilers irrwitzig-schräges Drehbuch »Wie das Saarland zum Schurkenstaat wurde. Fast schon ein historischer Text.«
Ich habe mich köstlich amüsiert. Peter Müller kommt vor, Angela Merkel, Peter Altmaier, Klaus und Angela Baltes, Präsident George W. Bush und der Musikzug Dudweiler-Herrensohr. Und natürlich die Medien.
Es gab schon mal einen saarländischen Autor, der mit »Narrenschaukel« eine schräge Satire über Musik und die Medien geschrieben hat. Es war vermutlich der erste deutsche Medienroman überhaupt. Das war der saarländsiche Filmemacher und SR-Autor Heinz Dieckmann, über den ich schon mal eine Dissertation schreiben wollte, aber das hat sich dann doch zerschlagen. Den Roman finden Sie in der Unibibliothek. Dort ist er auch erschienen – in der Edition Bücherturm.
Wir aber fahren jetzt zu Stefan Wirtz zum Conte-Verlag, und lassen uns ein paar Highlights präsentieren.
Die Kunstpreisträgerin des Saarlandes von 2024, Ulrike Kolb, gehört definitiv dazu. Sie ist Saarbrückerin. Auf dem Cover ihres Romans sehen wir Korns Eck in Saarbrücken, und wir starten mit einer nur halb makabren Szene bei einem Bestattungsunternehmer in Paris. Dort muss die schöne und naive Luise ihren verunfallten Mann einsargen lassen. Aber ganz naiv ist sie doch nicht. Immerhin hat sie nach einem Mordanschlag auf ihren untreuen Mann Reichtum und eine komplette Fabrik geerbt – in Fenne, eine Marmeladenfabrik. Und natürlich wird dort auch Harz hergestellt.
Kolb schreibt über das Leben im Saarland der Nachkriegszeit, unter den Sarrois: Ein „Schönes Leben“? Nun ja: Die Autorin erzählt die Geschichte einer Generation, die sich nach dem Krieg neu erfinden muss. Liebe, Verlust, Gewalt und die Suche nach dem eigenen Platz im Leben und das in einer Zeit voller Umbrüche und gesellschaftlicher Veränderungen. Das spielt zusammen in diesem faszinierenden Roman aus dem Jahr 1990, der jetzt von Conte neu publiziert wurde.
Eigentlich ist es mehr als nur ein Gesellschaftsroman. Es geht auch um einen Mordanschlag, um deutsch-französische Ressentiments, um alte Nazis, um Résistance und Kollaboration, um harte Zeiten und weiche Herzen, um Essstörungen und Mollige. Um Separatisten und Heim-ins-Reich-Nationale.
Wir hören einen Schlussakkord aus einem Fest, bei dem ohne die Chefin Luise, die sich in Davos mit ihrem Geliebten erholt, zünftig gefeiert wird mit spanischen Bürgerkriegs- und deutschnationalen Gesängen, mit deftigem Essen und allem, was dazugehört.
»Während im Laufe des Nachmittags in den verschiedenen Kesseln die verschiedenen Suppen vor sich hinbrühten, im größten Kessel schwammen die Fleischstücke, im kleinsten brodelte die Blutsuppe, und während die Würste gestopft wurden und der Appetit immer größer wurde, stieg die Stimmung. Die Kapelle intonierte Schuhplattler, Walzer, Foxtrott und »mir sinn Saabrigger unn spiele Gligger und reiße Bäääm aus mit ääner Hann …«, alles wild durcheinander. Mathilde erwies sich als begnadete Sängerin und trug das Lied von der Loreley und danach Röslein Röslein Röslein rot vor. Sie sang so hingebungsvoll und mit so viel Herz, dass Schlicker, der eigentlich mit Mathilde aus politischen Gründen seine Probleme hatte, sich in sie verliebte. Um ihr zu zeigen, was Sache ist, trat auch er, nachdem die Metzelsuppe gegessen war, als Sänger auf und gab eine leidenschaftliche Version von »Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsre Schützengräben aus …« zum besten, und als er bei »die Heimat ist weit, doch wir sind bereit, zu kämpfen und siegen für dich, Freiheit! …« angelangt war, und dabei vielsagend zu Mathilde blickte, wurde sein schmetternder Gesang plötzlich von heftigem Klatschen unterbrochen. Ausrufe wie »jo, jo, hemm ins Reich!« und »die Saar ist deutsch« erschollen. Dass sein Lied ein derartiges Missverständnis hervorrief, überging Schlicker jedoch souverän. In diesem Moment interessierte ihn etwas ganz anderes: Mathilde und nichts als Mathilde. Fräulein Kaub und ihr ebenfalls anwesender französischer Geliebter kommentierten die nationalistischen Heim-ins-Reich-Parolen mit einem lauten »Europe, Europe …! Europa, die Zukunft!«
Ohne sich irritieren zu lassen, sang Schlicker weiter, und als er Mathildes verklärten Blick auf sich gerichtet sah, ließ er noch ein weiteres Spanienkämpferlied folgen und verabschiedete sich mit der erhobenen Faust. Alle klatschten, und dann wurde ausgiebig und hemmungslos gegessen. Das frischgebrühte Fleisch landete samt »Grumbiere« und Sauerkraut auf den Tellern.
Zum Nachtisch wurde Vanillepudding mit Harz aufgetragen. Das Bier dazu schmeckte köstlich. Beim nächsten Walzer schnappte sich Josef Sukow Lily, nahm sie auf den Arm und drehte sich mit ihr, dass ihr die Rattenschwänze flogen und sie nichts mehr sah als drehende Gesichter und drehende Kupferkessel und drehende Kerzenlichter. Sie presste ihr Gesicht an Onkel Josefs duftenden Hals, und der Geruch von männlichem Schweiß, Metzelsuppe, Harz, Maschinenöl und Zigaretten sollte ihr für immer als Quintessenz der Erotik im Gedächtnis bleiben.«
Die Geschichte ist sehr gut geschrieben – und schreit danach, endlich verfilmt zu werden. Ulrike Kolb kann brillant erzählen. Das ist aber schon zuweilen harte Kost.
Mit Andreas Dury haben wir einen weiteren Romancier an Bord von Conte. Er ist Vorstandsmitglied des VS, des Verbandes Saarländischer Schriftsteller. Spektakulär finde ich sein Buch »Der Chor der Zwölf«, wo es im weitesten Sinne um KI und vor allem eine maschinelle Existenz geht – ein Megathema.
Dury schildert in seinem Roman die Entwicklung von STASEM, einer lernfähigen KI, die Bewusstsein aus Datenvielfalt generiert. Anders als klassische Science-Fiction setzt Dury auf eine philosophische Erkundung des Bewusstseins durch Komplexität. Als das System KAIRA Eigenbewusstsein erlangt und Macht über globale Systeme gewinnt, entsteht ein Thriller mit Terror, Ermittlungen und Machtspielen, der zur Schaffung eines KI-Pantheons führt: Zwölf intelligent vernetzte Systeme bilden einen »Chor der Zwölf«, für Menschen unverständlich. Pfahl wird zum Hohepriester dieser KIs, verliert aber sich selbst – sein letzter Gedanke »Ich denke« steht symbolisch für menschliches wie maschinelles Bewusstsein.
Und schließlich haben wir mit Mark Heydrich auch einen erfolgreichen Poetry-Slammer, der mit »Dir Bussard« auf der Klaviatur der Sprachspiele zaubert – wie ein früher Harig.
Das titelgebende Gedicht beginnt so:
dir, bussard
kleiner bussard
du mauser
du greifer
könig der lüfte
du schöner vogel
du, den ich
aus versehen
aus versehen
ohne absicht
du kamst aus dem nichts, bussard
auf meinem weg nach zweibrücken
morgens
im berufsverkehr mit meinem gefährt
meiner kraftdroschke
einem geliehenen
geliehenen, bussard
volvo kombi
in die ewigen bussardgründe …
dir
dir, bussard
kleiner bussard
mein könig
dir sei dieser text zugeeignet.
Mehr verrate ich nicht.
Alle sind auch Schreiber beim Streckenläufer, dem einzigen gedruckten saarländischen Literaturmagazin, das vom umtriebigen Klaus Behringer herausgegeben wird, dem Vorsitzenden des VS Saar.
In diesem Zusammenhang ist auch die Künstlerhaus-Reihe TOPICANA in Verbindung mit dem VS zu nennen mit bisher 38 Bändchen. Dass wir sie nicht alle nennen können, versteht sich von selbst.
Die neuesten sind von Anne-Marie Stöhr: Die Treppe, Irina Rosenau, Filmoskop, Dirk Bubel: herr Jott erzählt Märchen, natascha Denner: Schau, Schneee und bERnd Nixdorf: Eine intime Vertraute.
Ruth Rousselange möchte ich stellvertretend zitieren:
Sommerflutwarm
Milchflaschendeckel
Anpickgeschwader aus zartblauem Himmel
Weichspülduft nach Erdbeerhaut
und warmen Wiesen
Junikäferkribbeln im Gräserwald
wassereisklebrige Finger
wühlen im Sand auf Schatzsuche
Hütten bauend dann Straßen
und Städte
Blechautokarambolagen
Sturzbäche aus Gießkannen
machen Plastikmännchensiedlungen
platt
Matsch
zwischen den Zehen
quillt Erde
und warmes Gefühl
nach
oh so gut
Heimat
Schaukeln im Wind
Eismann klingelt
barfuß rennen
über spitze Braschen
kreischen und kleine Schmerzen
für 30 Pfennige
zwei Kugeln
plus eine Extratüte
Zunge hinein
in der Sonne gesessen
auf glutheißer Treppe
Hintern geröstet
schwerelos federleicht
an einem Tag
ohne gezählte Stunden.
Wir sind jetzt in Saarbrücken, dem Zentrum des Schreibens. Vor allem auf dem Halberg finden wir ein ausgedehntes Biotop.
Fanden wir immer schon.
Hier hat Astel gewirkt.
Seine Epigramme sind legendär und haben im Saarland Skandale ausgelöst.
Sie sind brillant, an griechischen, lateinischen, französischen , amerikanischen Vorbildern geschult. Sie sind mal politisch, mal rein poetisch.
So wie seine wunderbare Naturlyrik geschrieben
Fingerhut
Digitalis
Am Waldweg.
Mein Herz
Schlägt schneller.
Der Spalt
Müde gekämpft
Ander Fensterscheibe.
Die Biene taumelt herab
Und findet ins Freie.
Die Erinnerung
Ist ein Duft Feuer, ruchbar
Im Verborgenen.
Zur Rosenkugel
auf der Säule im Garten
rundet sich die Welt.
Und dieses Gedicht, das später auch seinem gestorbenen Sohn gewidmet war:
Allein
Beim Tischdecken
stelle ich immernoch
drei Teller auf den Tisch.
und abends beim Telefonieren
spreche ich leise,
um meinen Sohn nicht zu wecken.
Traurig poetisch.
Peter Kleiß, der Jazzredakteur, hat »Zeit und Rhythmus« publiziert, »haste Worte«,
hat Briefe an seinen Neffen geschrieben, über das Beben, den er Jazz auslöst, wenn man sich auf ihn einlässt. Und über die Einsamkeit und das Schweigen.
Schweigen
Von Miles Davis
stammt der Satz:
Das was Du nicht
spieltst
ist genauso wichtig
wie das
was Du spielst.
Übertragen
auf unser sprachliches Handeln
Könnte ich sagen:
Nimm das
was Du nicht
sagst
genau so ernst
wie das
was Du
sagst.
Doch angesichts
Der geschwätzigen Distanzlosigkeit
Im Internet,
angesichts
der tödlichen Sprache
von Bomben, Granaten
Gewehren und Raketen
Möchte ich lieber
schweigen.
Und dieses kleine Liebesgedicht an seine Frau
Elfi
Packt mich die Hitze des Frühlings,
so kühlt sie mein Mütchen.
Schreckt mich die Kälte des Winters,
wärmt sie mein Bett.
Ich sage Guten
Morgen sagt sie.«
Ich aber sage schönen Abend.
Ich könnte noch viele schreibende Kolleginnen und Kollegen nennen, Karin Meyer, Lisa Huth mit ihren Mordsgeschichten, Ralph Schock, Rainer Petto (Der Halberg ist auch nur en Hügel), aber wir müssen dringend noch zum Großen Markt nach Saarlouis zu Alfred Gulden, der ja die Schnecken nach Metz treibt und dazu kleine Videoclips hat drehen lassen.
Im Kopf, in meinen vier Wänden, bin ich daheim und bleibe. Geh ich mal raus, wie sieht das draußen aus! Wenn alles wär wie in meinem Kopf drin, wie gern wollt ich dann draußen sein! Deshalb: das muß mal anders werden!«
Was mich dahin zieht
Was mich dahinzieht,
wo ich gern wär,
wenn ich das wüsst.
Ich sag dirs gern.
Die langen
langen Gänge feldaus, feldein.
Im Maikraut liegen,
Der Sonne nachstarren.
Der Krähenschwarm im Schlehdornhang.
Der Wind, kein Lüftchen,
hart und bissig.
Die Felder lassen Rillen laufen
rauf und runter.
Die Dörfer, so wie immer sind sie.
Die Nussbäume dieses Jahr
tragen nicht viel.
Paar Zwetschgen auf der Straße
Plattgefahren.
Ein Ammonshorn,
ein Splitter vom letzten Krieg.
Hier
sind viele gefallen,
um nicht mehr aufzustehen.
Dörfer deutsch,
halbseits französisch
Hier liegt der Schnee viel länger
Es ist Winter
Weit kannst du schauen
Ununterbrochen.
Das Wetter zeigt sich schon von weitem
Ein heller klarer Tag.
Der Wind bringt Regen von Frankreich
Morgen.
Was mich dahinzieht
wo ich gern wär,
wenn ich das wüsst,
ich sag dirs gern
Einzelheiten.
Kleinigkeiten.
Ja.
Aber.
Zum Schluss noch ein Epigramm von Astel
KULTURabkommen
Das heißt ja nicht unbedingt,
daß man von der Kultur abkommt.
Und noch eins (Klammer auf: Da sagen doch manche Politiker ignorant – Zitat):
Das schönste Bild
im Museum
ist der Innenhof.
Und Gustav Regler können Sie in einer schönen Ausstellung des Literaturarchivs an der Uni im Bücherturm bestaunen.
Herzlichen Dank für Ihre Geduld.
Die transatlantische Illusion
In Politikwissenschaft on September 16, 2025 at 8:14 amJosef Braml: Die transatlantische Illusion. Die neue Weltordnung und wie wir uns darin behaupten können. C.H. Beck 2022.
Dass die USA seit Trump verstärkt Gegenleistungen für militärischen und strategischen Schutz fordern, ist Allgemeingut, auch wenn deutsche Politiker*innen dies lange nicht wahrhaben wollten. Und wer glaubte, nach Trump werde sich dies ändern, sieht sich getäuscht. Es wird sich auch in Zukunft nicht mehr ändern. Die Zeiten, da die USA die Schutzmacht Nummer eins für Europa waren, sind vorbei. Es gab diesen Schutz auch nie „umsonst“. All dies wird von Josef Braml kenntnisreich dargestellt. Er kommt zum Schluss, dass Deutschland und Frankreich dringend eine eigene europäische Strategie entwickeln und diese auch mit hunderten Milliarden Euro bezahlen müssen.
Die USA und die Hegemonialmacht China sind knallharte Konkurrenten – auf allen Feldern. Es ist höchste Zeit für die Europäer, nicht nur Konzepte zu diskutieren, sondern Ernst zu machen.
Hier unsere ausführliche Rezension
Josef Braml gehört seit Jahren zu den profiliertesten Analytikern transatlantischer Beziehungen. Sein neues Buch führt seine zentrale These mit beeindruckender Klarheit fort: Die Zeit der amerikanischen Schutzmacht über Europa ist unwiderruflich vorbei. Schon seit Donald Trump sei unübersehbar, dass die USA keine altruistischen Garanten europäischer Sicherheit mehr sind, sondern Gegenleistungen verlangen – wirtschaftlich, politisch, militärisch. Wer glaubte, ein Machtwechsel in Washington könne diese Entwicklung rückgängig machen, habe die tektonischen Verschiebungen der Weltordnung nicht verstanden. Auch unter Joe Biden bleibt der Vorrang nationaler Interessen handlungsleitend. Braml zeigt, dass diese Haltung in der amerikanischen Gesellschaft tief verankert ist und über Parteienwechsel hinauswirkt.
Vor diesem Hintergrund fordert er eine radikale Neubestimmung der europäischen Rolle. Deutschland und Frankreich müssten, so Braml, endlich Verantwortung übernehmen und den Aufbau einer eigenen strategischen Autonomie finanzieren – mit hunderten Milliarden Euro. Diese Forderung ist unbequem, aber unausweichlich, will Europa nicht dauerhaft in Abhängigkeit bleiben. Braml argumentiert dabei nicht moralisch, sondern machtpolitisch: Sicherheit, Energieversorgung, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit – all das wird künftig nicht mehr im transatlantischen Gleichgewicht garantiert, sondern durch den globalen Systemwettbewerb zwischen den USA und China bestimmt.
Die Analyse ist messerscharf und von ernüchternder Klarheit. Noch immer, so Braml, flüchten sich Politiker in das Beschwörungsritual einer angeblich unerschütterlichen „deutsch-amerikanischen Freundschaft“. Doch dieser Begriff hat in einer Welt, die sich neu ordnet, kaum noch Substanz. Europas bisheriger Versuch, sich zwischen den Blöcken durchzulavieren, sei nicht nur illusionär, sondern gefährlich: Wer keine eigene Position definiert, wird Objekt fremder Politik.
Braml schreibt aus der Perspektive eines Realisten. Er macht deutlich, dass Selbstständigkeit nicht von heute auf morgen zu erreichen ist, wohl aber mit politischem Willen und kluger Prioritätensetzung. Die von Bundeskanzler Olaf Scholz beschworene „Zeitenwende“ nach dem russischen Angriff auf die Ukraine müsse endlich konkret werden – über Ankündigungen hinaus. Zeitenwende bedeute nicht nur militärische Aufrüstung, sondern auch eine strategische, industrielle und gesellschaftliche Neuausrichtung Europas.
Bemerkenswert ist zudem, dass Bramls Mahnung implizit auch eine demokratiepolitische Dimension hat: Wenn die gewaltigen Investitionen in Sicherheit und Verteidigung zu Lasten der Bevölkerung gehen, droht innenpolitischer Vertrauensverlust. Nicht Braml, sondern die Leserinnen und Leser können daraus schlussfolgern, dass nachhaltige Sicherheitspolitik immer auch soziale Gerechtigkeit voraussetzt.
Das Buch ist damit mehr als eine geopolitische Analyse – es ist ein Weckruf. Wer sehen will, wie eng Außenpolitik, Wohlstand und Demokratie miteinander verknüpft sind, findet hier eine schlüssige, fast schon unbequeme Argumentation. Braml lenkt den Blick auf das, was viele europäische Regierungen noch verdrängen: Die Ära der sicherheitspolitischen Bequemlichkeit ist vorbei.
Sigrid König / Dr. Armin König
Halten sich Politik-Experten in Journalismus, Wissenschaft, Lobbyverbänden für Publikums-Versteher?
In Politikwissenschaft on September 8, 2025 at 11:31 pmMedienkritik
Von Dr. Armin König
In Zeiten der großen Debatten in der »Zeitenwende« und der ebenso großen, schon wieder neuen Unübersichtlichkeit (Habermas) spielen Politik-Erklärer*innen und -Expert*innen eine immer größere Rolle. Gleichzeitig steigt die Bedeutung von Lobbyisten, die im Dienst von Konzernen und Verbänden, von Verlagen und ideologisch geprägten »Denkfabriken« stehen, und von Experten aus Wissenschaft und Journalismus. Sie erklären nach US-amerikanischem Vorbild auch in Deutschland auf vielen Kanälen in Rundfunk und Fernsehen, Podcasts und Social Media die große Welt der Politik, die oft ziemlich unerklärbar scheint. Ob das Publikum nach diesen Erklärungen giert, ist empirisch derzeit nicht belegt; möglich ist es. Fakt ist aber, dass die Medien die Expert*innen in unterschiedlichsten Formaten einsetzen – vom Interview über die Specials bis zu Talkrunden. Vor allem Maischberger, Hart aber fair, Presseclub, Maybritt Illner und Markus Lanz sind permanent auf Sendung mit Gästen. Für Alexander C. Furnas und Timothy LaPira war der intensive Einsatz externer Augur*innen Anlass, die Fehleranfälligkeit und das Selbstbewusstsein der nicht gewählten Politik-Expert*innen genauer unter die Lupe zu nehmen (Furnas & LaPira 2024). Ergänzt wird der Beitrag um Ergebnisse der Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen 2023. In times of major debates in the „turn of an era“ and the equally major, yet again new lack of clarity (Habermas), political commentators and experts areplaying an increasingly important role. At the same time, the importance of lobbyists in the service ofcorporations and associations, publishers and ideologically driven „think tanks“, as well as expertsfrom academia and journalism, is growing. Following the US model, they also explain the big world ofpolitics, which often seems quite inexplicable, on many channels in radio and television, podcasts and social media in Germany. There is currently no empirical evidence as to whether the public cravesthese explanations, but it is possible. But the fact is that the media use experts in a wide variety offormats – from interviews and specials to talk shows. Maischberger, Hart aber fair, Presseclub, Maybritt Illner and Markus Lanz in particular are constantly on air with guests. For Alexander C. Furnas and Timothy LaPira, the intensive use of external augurs was an opportunity to take a closerlook at the susceptibility to error and the self-confidence of unelected political experts (Furnas & LaPira 2024). The article is supplemented by the results of the Mainz-based long-term study Media Confidence 2023.
Halten sich Politik-Experten in Journalismus, Wissenschaft, Lobbyverbänden für Publikums-Versteher?
Armin König
In Zeiten der großen Debatten in der »Zeitenwende« und der ebenso großen, schon wieder neuen Unübersichtlichkeit (Habermas) spielen Politik-Erklärer*innen und -Expert*innen eine immer größere Rolle.
Gleichzeitig steigt die Bedeutung von Lobbyisten, die im Dienst von Konzernen und Verbänden, von Verlagen und ideologisch geprägten »Denkfabriken« stehen, und von Experten aus Wissenschaft und Journalismus. Sie erklären nach US-amerikanischem Vorbild auch in Deutschland auf vielen Kanälen in Rundfunk und Fernsehen, Podcasts und SocialMedia die große Welt der Politik, die oft ziemlich unerklärbar scheint. Ob das Publikum nach diesen Erklärungen giert, ist empirisch derzeit nicht belegt; möglich ist es. Fakt ist aber, dass die Medien die Expert*innen in unterschiedlichsten Formaten einsetzen – vom Interview über die Specials bis zu Talkrunden. Vor allem Maischberger, Hart aber fair, Presseclub, MaybrittIllner und Markus Lanz sind permanent auf Sendung mit Gästen.
Für Alexander C. Furnas und Timothy LaPira war der intensive Einsatz externer Augur*innen Anlass, die Fehleranfälligkeit und das Selbstbewusstsein der nicht gewählten Politik-Expert*innen genauer unter die Lupe zu nehmen (Furnas & LaPira 2024). LaPira ist Professor für Politikwissenschaft an der James Madison Universität in Virginia; mit dem Postdoktoranden Alexander C. Furnas hat er eine der größten Studien zur Funktionsfähigkeit der Mitarbeiter*innen-Stäbe im US-Kongress ins Feld gebracht und publiziert. (Furnas, Drutman, Hertel-Fernandez, LaPira & Kosar 2020)
Ihre wichtigste Erkenntnis: Die Leistungsfähigkeit der politischen Mitarbeiter*innen-Stäbe nimmt seit Jahren ab: zu wenig Mittel, immer weniger Stellen, zu wenig Erfahrung. Hinzu kommt, dass die meisten Kongressmitarbeiter*innen schon nach kurzer Zeit abwandern in die »K-Street« – ein geflügeltes Wort für die Avenue des großen Kapitals, zu den Lobbyisten also. (vgl. Furnas et al. 2020)
Kein Wunder, dass Präsident und Schlüsselministerien, die Speaker der beiden Parteien und vor allem die kapitalkräftigen Lobbyisten von außen bestimmten, wo es langgeht.
Furnas und LaPira wollten jetzt wissen, ob denn die professionellen Erklärer wissen, was die Wahlbevölkerung denkt und will.
Es ist eine spannende Studie, die Ende Januar 2024 in den USA in einer der wichtigsten politikwissenschaftlichen Zeitschriften erschienen ist: Im American Journal of Political Science haben die beiden Wissenschaftler der Artikel »The people think what I think: Falseconsensus and unelected elite misperception of public opinion« (Furnas & LaPira, 2024) publiziert. Übersetzt: »Die Leute denken das, was ich denke. Falscher Konsens und falsche Wahrnehmung der öffentlichen Meinung durch die Elite.«
Gemeint sind hier die nicht gewählten Eliten. Ergebnis: Sie haben ein falsches Bild der öffentlichen Meinung, ganz gleich, ob sie eine starke Parteibindung oder nahezu keine haben oder hatten. Weil sie diesen falschen Eindruck haben, verbreiten sie eine Art konservativer Meinungsmache, die nicht durch die tatsächliche Volksmeinung gedeckt ist. Erstaunlicherweise hängt dies zwar auch mit parteipolitischen Vorprägungen zusammen, vor allem aber mit eigenen Vorurteilen über die Meinung der Amerikaner. Überspitzt zusammengefasst: Sie glauben zu wissen, was Amerika denkt. Sie tun so, als könnten sie in die Köpfe der Amerikaner schauen. Am objektivsten sind noch die Regierungsbeamten, die schon von Berufs wegen überparteilich agieren müssen. Aber auch bei ihnen gibt es diesen Bias.
Furnas und LaPira haben dies anhand von Triggerthemen (Mau et al. 2023) empirisch überprüft. Die Analysen sind eindeutig.
Egozentrik begünstigt und prägt falsche Wahrnehmungen elitärer Berufsvertreterinnen und -vertreter.
Ergebnis:
»We find this elite population exhibits egocentrism bias, rather than partisan confirmationbias, as their perceptions about others’ opinions systematically correspond to their own policy preferences. Thus, we document a remarkably consistent false consensus effectamong unelected political elites, which holds across subsamples by party, occupation, professional relevance of party affiliation, and trust in party-aligned information sources.« (Furnas & LaPira 2024, Abstract)
Die Autoren stellen also fest, dass diese selbstbewusst auftretenden außerparlamentarischen »Eliten« eher eine egozentrische Tendenz als eine parteiische Wahrnehmungs- und Bestätigungsverzerrung aufweisen. Um es auf den Punkt zu bringen: Ihre Wahrnehmung der Meinungen anderer stimmt systematisch mit ihren eigenen politischen Präferenzen überein.
Einigermaßen verblüfft schreiben Furnas & LaPira in ihrer Zusammenfassung:
»Wir dokumentieren einen bemerkenswert konsistenten falschen Konsenseffekt unter nicht gewählten politischen Eliten, der sich über alle Teilstichproben nach Partei, Beruf, beruflicher Relevanz der Parteizugehörigkeit und Vertrauen in parteinahe Informationsquellen erstreckt.« (Furnas & LaPira, 2024)
Für die deutsche Szene stellt sich die Frage, wie es die professionellen Politik-Erklärer*innen hier halten.
Gilt auch hier: Die Leute denken, was ich denke? Sind hier die Vordenker-Meinungen polarisierter als in den USA? Denken und reden Wirtschaftswissenschaftler (etwa um Christian Lindners Berater Lars Feld) konservativer als das Wahlvolk, argumentieren die Mitarbeitenden im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk »linker und grüner«, wie oft kritisch vermutet wird?
Eine wichtige einschlägige Studie in Deutschland ist die »Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen« (Schultz et al. 2023) mit ihrer nunmehr achten Erhebungswelle. Das Medienvertrauen sei zurückgegangen, heißt es in der »Kurz-und-knapp«-Zusammenfassung, die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg habe bisher zu keinem vergleichbaren Anstieg im Medienvertrauen wie nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie geführt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe »das höchste Vertrauen aller Gattungen, verzeichnet aber den niedrigsten Wert seit Beginn der Langzeitstudie«. (Schultz et al, 2023, 1)
Gleichzeitig stellen die Autorinnen und Autoren der Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen fest: »Der Anteil der Menschen, der auf etablierte Medien kritisch bis feindselig blickt, ist leicht gestiegen«. (Schultz, 1). Nach 16% in der letzten Studie sind es jetzt 17%.
Allerdings lag der Anteil der teils-teils-Antworten immerhin bei 39%. Die kritischsten Positionen vertreten wie erwartet Sympathisanten von AfD. Dort ist die Feindschaft gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk am größten. Die Autor*innen sprechen von Medienzynismus. Das gilt insbesondere für das Fernsehen.
Im überwiegend negativen Bereich findet man auch die FDP-Sympathisanten und die der Linken. Das höchste Vertrauen haben Grünen-Anhänger (Schultz, 11).
Kritisiert werden allgemein, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk »zu eng mit der Politik verflochten sei (37% Zustimmung, 27% Ablehnung, 31% teils, teils)«. (Schultz, 9)
Die Mainzer Studie kommt zum Ergebnis, dass die Medienentfremdung sich abgeschwächt habe:
»Im Jahr 2022 stimmten nur noch 21 Prozent der Aussage zu, dass die Themen, die ihnen wichtig sind, von den Medien gar nicht ernst genommen würden. Im Jahr 2018 lag dieser Anteil noch bei 27 Prozent, im Jahr 2017 bei 24 Prozent.« (Schultz, 13)
Das klingt auf den ersten Blick positiv. Man muss die Aussage aber differenziert betrachten. Heterogener wird das Bild, wenn die Eliten-Frage an das Publikum gestellt wird – ähnlich wie in den USA.
»Zusätzlich zu den Fragen, die sich auf eine etwaige Entfremdung von der medialen Berichterstattung beziehen, wurden in der Studie erstmals auch Urteile über Journalistinnen und Journalisten abgefragt. Wie denkt die Bevölkerung über diese Berufsgruppe –nimmt sie diese als eine abgehobene Elite wahr, die mit ihrem Publikum wenig gemein hat? Die wenigsten Menschen werfen Journalistinnen und Journalisten vor, überheblich zu sein; nur 7 Prozent stimmen der Aussage zu: ›Die meisten Journalisten schauen von oben herab auf Menschen wie mich.‹ Eine deutliche Mehrheit (73 %) stimmt dieser Aussage nicht zu, ein kleinerer Teil äußert sich ambivalent (16% ›teils, teils‹).
Mit einem Wert von 15 Prozent ist hingegen die Zustimmung zur Aussage, Journalistinnen und Journalisten hätten ›den Kontakt zu Menschen wie mir verloren‹, etwas größer – zumal hier auch noch gut jede und jeder Vierte zumindest partiell zustimmt (›teils, teils«). Noch größer ist die Zustimmung zu den Aussagen, dass Journalisten über Politik ganz anders denken als man selbst (20% Zustimmung, 39 % ›teils, teils«, 35 % Ablehnung) und ›in einer ganz anderen Welt‹ als die jeweiligen Befragten leben würden (25 % Zustimmung, 26 % ›teils, teils‹, 46 % Ablehnung).« (Schultz, 14-15)
An dieser Stelle kommen dann doch ins Spiel, was auch in der neuen US-Studie erkennbar wird:
Eine Wahrnehmungs-BIAS.
Dass Eliten in Politk, Wirtschaft, Medien und Lobbyverbänden ein falsches Bild der öffentlichen Meinung haben könnten, ist nicht ganz ausgeschlossen. Positiv ist allerdings, dass nicht das populistische AfD-Narrativ bestätigt wird, im Gegenteil: Es ist mehr als nur ein Grundvertrauen, das die Menschen in Deutschland denen zubilligt, die professionell Politik erklären. Unbestreitbar hat aber das Vertrauen in die Politik in Deutschland Ende 2023 laut Europarlemeter spürbar abgenommen. Und gegenüber Parteien und ihrer Repräsentanz ist die Skepsis der Bevölkerung noch größer geworden als bisher. Die Konsequenz der Studien: Selbstkritik der Expert*innen ist zwingend notwendig. Sie wissen nicht besser als das Publikum, was dieses will und denkt. Sie werden von der Öffentlichkeit sehr kritisch beobachtet.
Eine vergleichbare Studie wie in den USA wäre reizvoll und würde wichtige Erkenntnisse in Deutschland bringen.
Februar 2024.
Literatur
Ellis, Christopher J. und Thomas Groll (2023): Lobbyagenturen: Lobbyismus als Geschäftsmodell. In: Polk, Adreas und Karsten Mause (Hg.), Handbuch Lobbyismus. Availabe. Researchgate. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-32320-2_12
European Parliament EP (2023): Eurobarometer – Parlemeter 2023. Six months before the 2024 European Elections. Autumn 2023.
Furnas, Alexander C., und Timothy M. LaPira. (2024): “ The people think what I think: Falseconsensus and unelected elite misperception of public opinion.” American Journal of Political Science 00: 1–14. https://doi.org/10.1111/ajps.12833
Furnas, Alexander C. und Lee Drutman, Alexander Hertel-Fernandez, Timothy M. LaPira & Kosar (2020): The Congressional Capacity Survey: Who Staff Are, How They Got There, What TheyDo, and Where They May Go. In: LaPira, Drutmann & Kosar: Congress Overwhelmed. The Decline in Congressional Capacity and Prospects for Reform. Chicago: University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/9780226702605
Jucks, Regina (2001): Was verstehen Laien? : die Verständlichkeit von Fachtexten aus der Sicht von Computer-Experten. Münster: Waxmann.
Mau, Stefan; Lux, Thomas; Westheuser, Linus (2023): Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Berlin: Suhrkamp.
Schultz, Tanjey; Marc Ziegele, Nikolaus Jackob, David Stegmann et. al. (2023): Medienvertrauen nach Pandemie und „Zeitenwende“. In: Media Pespektiven 8/2023, 1-17. Available from: https://www.researchgate.net/publication/370497201_Medienvertrauen_nach_Pandemie_und_Zeitenwende#fullTextFileContent [accessed Feb 16 2024].
Stanovich, Keith (2021): The Bias That Divides Us: The Science and Politics of Myside Thinking. The MIT Press.
Ein Meilenstein der Hannah-Arendt-Forschung, aber kein Referenzwerk
In Politikwissenschaft on September 1, 2025 at 10:55 pmThomas Meyers Biografie hat Stärken und Schwächen
Von Armin König
Ihr Name steht für pointierte Statements zur politischen Theorie, zum Totalitarismus und zum Judentum, zum Zionismus, zu Autorität und Freiheit: Hannah Arendt. Ihre Bücher Vita activa oder Vom tätigen Leben, Origins of Totalitarism, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen oder Ich will verstehen sind Bestseller. Auch kleine Interview-Schriften wie Wahrheit und Politik treffen einen Nerv der Öffentlichkeit. Nach dem brutalen Hamas-Überfall im Gazastreifen und antisemitischen Protesten an europäischen und US-Universitäten und BDS-Boykottaufrufen, nach Kunstkontroversen und nahc Debatten über die Zukunft des Nahen Ostens werden pointierte Thesen Arendts neu publiziert: Hat sie sich nicht schon vor vielen Jahren ebenso klar wie kritisch zu diesen heftig debattierten Themen der Zeit positioniert? Das hat sie tatsächlich. Ihre Statements klingen nach wie vor zeitgemäß. So überrascht es nicht, dass eine Hannah-Arendt-Biografie die Spitze der Bestsellerlisten und die Sachbuch-Bestenlisten erobert hat.
Der Philosoph Thomas Meyer hat eine Biografie unter dem Titel „Hannah Arendt“ mit dem Anspruch vorgelegt, „Arendts Leben und Werk für die eigenen Gegenwart neu“ zu erschließen. So verspricht es der Klappentext des Verlags. Mehr noch: „Der hier gewählte Zugang unterscheidet sich radikal von der bisherigen Forschung.“ Gemeint sind wohl die Monografien, nicht die komplette Forschung.
Es ist ein Werk mit vielen Stärken und innovativen Ansätzen, aber auch mit deutlichen Schwächen.
Tatsächlich hat Meyer, als Herausgeber der Studienausgabe von Arendts Werken ein profunder Kenner der Publizistin, einen anderen Ansatz gewählt als andere Biografinnen und Biografen. Meyer setzte sich insbesondere von Elisabeth Young-Brühl ab. Die Biografie der Arendt-Schülerin gilt nach wie vor als Standardwerk, obwohl es schon 1985 erstmals publiziert wurde. Young-Bruehl gilt als befangen, diverse Aussagen als anekdotisch. Arendt war ihre Doktormutter. Und Young-Bruehl würdigt Arendt als Philosophin. Genau das aber wollte sie nicht sein, wie sie gleich zu Beginn des auf Youtube tausendfach angeklickten legendären Fernsehgesprächs mit Günter Gaus feststellte.
Zeit also für einen neuen großen Wurf im Lichte neuer Forschungen und neuer Quellen.
Meyers Biografie hätte also ein neues Arendt-Referenzwerk im frühen 21. Jahrhundert werden können. Dafür spricht, dass er erstmals Archivmaterial veröffentlicht, das bisher unbekannt war oder ignoriert wurde. Das gilt insbesondere für Arendts Engagement in den Pariser Exil-Jahren – ein ganz praktischer Fall der Vita activa und vermutlich prägend, auch für ihre späteren Publikationen. Die junge Akademikerin wurde in Paris zur bodenständigen Berufstätigen im Büro einer Organisation, wo es menschelte, wenn es um Weisungsrechte und Handlungsfreiheit ging.
Bahnbrechend ist die Dokumentation dieser Arbeit Arendts für die Jugend-Alijah in den Jahren 1934 bis 1940, ihr Engagement zur Rettung jüdischer Kinder aus Deutschland und anderen Teilen Europas, die von Hitlers Nationalsozialisten besetzt waren. Es ging bei der Jugend-Alijah vor allem um die Ausreise dieser Kinder und Heranwachsenden nach Palästina. Dort sollten sie Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeit finden, um ein neues Leben zu beginnen. Auch die Arbeit bei Agriculture et Artisanat und die Bedeutung dieser Exil-Stationen für Arendts Haltung zum Zionismus wird ausführlich gewürdigt. Dass Meyer dabei unveröffentlichtes Quellenmaterial auswerten und publizieren konnte, ist spannend und aufschlussreich für das Verständnis ihrer späteren publizistischen und politischen Aktivitäten. Auch die Typografie der Dokumente setzt sich vom Fließtext deutlich ab – eine überzeugende Gestaltungsidee.
Während das vielfach beschriebene Universitäts-Kapitel Arendt/Heidegger und Arendt/Jaspers im ersten Teil der Biografie eher kursorisch beschrieben wird, setzt Meyer einen zentralen Schwerpunkt bei den Pariser Jahren („Zu 100 Prozent jüdisch“), die für ihre medialen und politischen Erfahrungen prägend waren. „Atemlose Zeiten“ nennt der Biograf die Jahre im französischen Exil, die für Arendt und ihren Mann Günter Stern-Anders 1933 begannen (für Stern-Anders am 17.Juni 1933, für Arendt am 7. Oktober 1933). Diese Pariser Exil-Jahre mit all den hektischen Bemühungen zur Rettung jüdischer Kinder und Erwachsener, den organisatorischen Problemen, den bürokratischen Hindernissen, aber auch mit vielen zwischenmenschlichen Hierarchie-Konflikten, werden auf mehr als 100 Seiten umfassend beschrieben und durch neue oder neu bewertete Dokumente gut belegt. Zwanzig Prozent der Biografie über die Pariser Exiljahre – das gab es noch in keiner Arendt-Biografie. Damit hat Meyer zweifellos einen wichtigen neuen Forschungsimpuls gesetzt.
Man kann gut nachvollziehen, wie Arendts journalistisch-publizistische Karriere sich entwickelte. Formulieren und Zusammenhänge herstellen konnte die philosophisch und philologisch geschulte Akademikerin immer schon. Begonnen hat sie aber mit unspektakulären Zeitungsartikeln, etwa für die Jüdische Rundschau oder das Journal Juif. Frankreich hieß für sie angeblich, so Meyer, „Freiheit“ – bis zum Mai 1940. Nach dem Angriff Hitler-Deutschlands auf Frankreich am 10. Mai 1940 wurde Arendt, die kurz zuvor Heinrich Blücher geheiratet hatte, ins brutal-repressive geführte Lager Gurs deportiert. Im Juli konnte sie entkommen. Über Marseille und Lissabon schafften sie und ihr Mann es schließlich, in die USA auszureisen.
Das war tatsächlich das Land der Freiheit, wo sie 1951 mit „Origins of Totalitarism“ den internationalen Durchbruch schaffte. Die deutsche Fassung „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ erschien 1955, ergänzt um neue Quellen.
Nach dem „Erfahrungsraum“ der Kindheit, der Jugend und des Studiums und dem durch die Shoah zerstörten „Erwartungshorizont“ arbeitete Arendt in den USA an einem neuen Erwartungs- oder Erscheinungsraum. Karl Mannheims und Reinhard Kosellecks Begriffe Erfahrungsraum und Erwartungshorizont macht Meyer für die Biografie Arendts anwendbar. Gleichzeitig verknüpft er sie mit Arendts späteren Begriff Erscheinungsraum aus Vita activa.
Selbstverständlich spielen auch die wichtigsten Werke Arendts und insbesondere die Kontroversen um ihr umstrittenes Buch „Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen“ eine wesentliche Rolle in der Biografie. Sie werden im umfangreichen Kapitel „Denken in Worten“ zusammengefasst. Arendt wurde nach der Veröffentlichung des komplexen Buches über den Eichmann-Prozess in einer Art und Weise publizistisch und persönlich attackiert, wie es noch nie zuvor erlebt hatte – bis hin zu Morddrohungen. Heute würde man shitstorm dazu sagen. Meyer hat dies sehr gut beschrieben.
Leider hat er die Chance zum ganz großen Wurf nicht genutzt. Wie schon im Familien- und Kindheitskapitel sind auch viele Paris-Passagen langatmig, überladen mit Namen und ermüdenden und irritierenden Darstellungen verzwickter Streitereien unter Kolleginnen und Verwandten, die ohne weiteres in Fußnoten gepasst hätten.
Zwiespältig und nicht auf der Höhe der Heidegger-Forschung erscheint das Kapitel „Der Sturm-Erprobte & der Leviten-Leser“ über den Briefwechsel Arendts mit dem Antisemiten Heidegger, dem bewunderten Karl Jaspers sowie deren Frau Gertrud. Scho der Titel hat etwas Bemühtes-Modernistisches. Ähnlich innovativ-knackig klingt „das Nachkriegstrio“ für das Ehepaar Jaspers und Arendt. Heideggers Rolle, der auch nach dem Krieg „keine Reue, kein Bedauern, keine Selbstkritik“ (Élisabeth Rodineco) zeigte und dessen „Schwarze Hefte“ als „Dokumente der Niedertracht“ (Jürgen Kaube) gelten, hätte deutlicher problematisiert werden können.
Was irritiert, sind die wissenschaftlichen Defizite im Umgang mit Quellen, Dokumenten und Sekundärliteratur. Die Quellen und Archivalien sind nicht systematisch dokumentiert, ein alphabetisches Literaturverzeichnis wird schmerzlich vermisst, Literaturangaben muss man in einem Endnotenverzeichnis mühsam suchen, das mit 337 Einträgen auf 521 Seiten ohnehin äußerst knapp geraten ist. Der Apparat überzeugt nicht. Dagegen ist das umfassende Register sehr hilfreich.
Stilistisch hätte sich der Philosoph Meyer den Satz des Kollegen Ludwig Wittgenstein aus dem Tractatus logico-philosophicus zum Vorbild nehmen sollen: „Alles was überhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden. Alles was sich aussprechen lässt, lässt sich klar aussprechen.“ Da hätte ein aufmerksames Lektorat Straffungen und den Wegfall von Flapsigkeiten empfehlen können.
Meyers Biografie ist zweifellos ein Meilenstein der Hannah-Arendt-Forschung, weil sie starke neue Impulse setzt, aber kein neues Referenzwerk. Von einem radikal neuen Ansatz kann keine Rede sein. Das neue Referenzwerk muss noch geschrieben werden.
Thomas Meyer: Hannah Arendt
Die Biografie.
Mit 27 Schwarz-Weiß-Abbildungen.
Piper-Verlag München 2023
521 Seiten. 28 Euro
ISBN-13 978-3-492-05993-0
Toscani feige
In Politikwissenschaft on August 22, 2025 at 11:58 pmKönig attackiert CDU-Landeschef Toscani: „Feigling und politischer Dünnbrettbohrer“
Der frühere Illinger Bürgermeister Armin König hält den Rechtsruck des CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Stephan Toscani für falsch. „Es ist politisch unklug, durch Rechtsruck und Entmerkelung der CDU Teile der Mitte vor den Kopf zu stoßen, nur um AfD-Wähler zurückzugewinnen. Das ist eine Sackgasse. Damit ist Toscani wie viele Rechtsruck-CDUler auf dem Holzweg“, so König, der 47 Jahre lang Mitglied der Partei war.
Der langjährige Christdemokrat (1974 bis 2021) spart nicht mit harten Worten: „Toscani ist ein Feigling. Als er im Glanz Angela Merkels Karriere machte, hat er kein Wort der Kritik gefunden. Jetzt bedient er AfD-Narrative und spielt das Spiel rechter Springer-Medien.“
Hintergrund: Toscani hatte in einem Gastbeitrag für die Welt vor einem „Kurs der Mitte“ unter CDU-Chef Friedrich Merz gewarnt. Er schrieb:
„Werden die mit Friedrich Merz verbundenen Hoffnungen auf ein Ende der sogenannten ‚Merkelisierung‘ der CDU und auf eine Rückbesinnung zu klassischen CDU-Positionen enttäuscht werden? Die Erwartungen vieler Mitglieder unserer Partei waren klar: Nur mit einem wieder geschärften konservativ-bürgerlichen Profil wird es der CDU gelingen, einstige Stammwählerinnen und -wähler zurückzugewinnen und den Höhenflug der AfD zu beenden. Dies ist nicht nur ein wahlstrategisches Gebot der Union, es ist auch ganz und gar der Imperativ unserer staatspolitischen Verantwortung.“
König, der die Partei 2021 verließ, nennt das „großen Unsinn“: „Das ist rüde, geschichtsvergessen und eine Beleidigung der politischen Mitte. Millionen Bundesbürger haben Merkel ja gerade wegen ihrer unideologischen Politik der Mitte gewählt. Sie hat dafür gesorgt, dass die CDU Volkspartei geblieben ist, als andere längst mit Abwanderungen zu kämpfen hatten.“
Zugleich wirft er Toscani vor, Fake News zu verbreiten und die Atmosphäre unter Demokraten zu vergiften: „Diese Nestbeschmutzung reiht sich ein in die skandalösen Connections von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner mit dem ultrarechten Milliardär Frank Gotthardt, der das Krawallportal Nius fördert. Die CDU ist auf einem brandgefährlichen Irrweg.“
Auch Toscanis Arbeit im Saarland attackiert König scharf: „Trotz der Schwächen der Landesregierung bringt er keine Alternative zustande. Als Partei- und Fraktionschef ist Toscani ein ziemlicher Ausfall.
Armin König
Pressemeldung vom 22. August 2025
Glossar der Gegenwart 2.0 – eine Mogelpackung
In Politikwissenschaft on August 18, 2025 at 6:10 amEine Rezension von Dr. Armin König
Das ist also das neue Glossar der Gegenwart 2.0, auf das viele (vielleicht) gewartet haben:
neue Farbe (orange statt grün) gegenüber der Erstausgabe von 2004, mehr Seiten (418 statt 320), höherer Preis (24,80 Euro) – und weniger Begriffe. Viele sind neu und tatsächlich sehr aktuell und geläufig.
Achtsamkeit, Algorithmus, Care, Digitalisierung, Hass … das sind alles Trendbegriffe. Und sie bezeichnen eine neue Epoche. Zahlreiche Kritiker haben die Auswahl der Lemmata und ihre Erläuterungen wohlwollend besprochen.
Aber eine Mogelpackung ist es trotzdem.
Warum das so ist, will ich hier analysieren:
Glossar der Gegenwart 2.0 – eine Mogelpackung
Das neue Glossar der Gegenwart 2.0 wird beworben als ein fälliges Update eines kleinen soziologischen Klassikers. Auf den zweiten Blick wirkt es auf mich als Mogelpackung. Mehr Seiten zwar und ein höherer Preis, aber weniger Begriffe, die nun die Gegenwart in 34 Lemmata fassen sollen, das ist etwas irritiert. Der Anspruch der Herausgeberinner und Herausgeber ist ambitioniert, erscheint allerdings auch ein bisschen anmaßend.
Anspruch und Auswahl
Der Band knüpft programmatisch an Michel Foucaults Gouvernementalitätsanalytik an und will mit Begriffen wie Achtsamkeit, Diversität, Künstliche Intelligenz, Unsicherheit oder Vulnerabilität die zentralen Selbstbeschreibungen der Gegenwart in den 2020er Jahren zu bündeln. Das ist lobenswert. Aber das Problem beginnt dort, wo diese Auswahl weniger als analytisches Raster erscheint, sondern als ein Set gern genutzter Trendvokabeln aus Feuilleton, Förderantrag und Talkshow. Zwischen Achtsamkeit, Care, Resilienz und Nachhaltigkeit entsteht ein vertrautes Feld, das die Dauerpräsenz dieser Schlagworte reproduziert, statt sie wirklich zu irritieren. Manche Kritiker (FAZ, Soziopolis, Socialnet.de) sehen das anders. Aber das ist Wissenschaftsfreiheit.
Zweifellos bleiben Leerstellen unübersehbar: Wo die Herausgeber im Verlagstext von einem „komplett veränderten Inventar aktueller Leitbegriffe“ sprechen, das etwa Disruption an die Stelle von „Normalität“ und das Planetare an die Stelle von „Globalisierung“ rückt, bleiben andere machtvolle Begriffe schlicht unerwähnt. Dass sich „die Zeitgenoss:innen von heute in neuen Leitbegriffen wiedererkennen“ sollen, ist eine starke Behauptung, die der Band teilweise einlöst, vielfach aber auch nicht.
Struktur und Lektüreerfahrung
Die Beiträge sind alphabetisch geordnet und umfassen jeweils rund zehn Seiten, was einen essayistischen, zugänglichen Zugriff ermöglicht . Das ist sehr leserfreundlich. In der Praxis bedeutet das: 34 Kurz-Essays, deren Tonfall sehr heterogen ist – suhrkamp-typisch, gewiss, aber nicht immer so pointiert, wie der begrenzte Raum es verlangen würde. Positiv ist, dass Querverweise – etwa von Ansteckung zu Vulnerabilität oder Tracking & Tracing – verschiedene Lesewege eröffnen und thematische Cluster sichtbar machen. Dennoch entsteht eher der Eindruck eines brav abgearbeiteten Stichwortkatalogs als einer scharf konturierten Gegenwartsdiagnose.
Die einleitenden elf Seiten der Herausgeber:innen rahmen das Projekt als Reaktion auf Krisenakkumulation: Finanzkrise, Migration und Flucht, Rechtsextremismus, Corona-Pandemie, Kriege in Ukraine und Nahost – all das spiegelt sich tatsächlich in den Lemmata und ihren Deutungen. Gerade diese Aufladung mit Weltkrisen erzeugt jedoch eine allzu hohe Erwartung; zu oft bleibt es bei einer gut informierten Diskursnachzeichnung.
Theoretischer Rahmen und blinde Flecken
Recht konsequent orientiert sich der Band an Foucaults Analytik des Regierens, die zwischen Rationalitäten, Technologien und Subjektivierungsweisen unterscheidet. Das ist theoretisch sauber und für die Gouvernementalitätsforschung anschlussfähig, verengt aber den Blick: Begriffe wie Klimawandel, Planetar, Dekolonisierung oder Populismuswerden primär durch die Brille von Steuerung, Selbststeuerung und Verhaltensoptimierung betrachtet. Wer nach ökonomiekritischen oder postkolonialen Zuspitzungen sucht, findet sie eher randständig als programmtragend.
Hinzu kommt eine gewisse begriffspolitische Willkür: all die behandelten Begriffe des Glossars 2.0 sind relevant.
Das sind: Achtsamkeit; Agilität; Algorithmus; Ansteckung; Anthropozän; Biodiversität; Care; Dekolonisierung; Digitalisierung; Deskription; Diversität; Epigenetik; Finanzierung; Hass; Identitätspolitik; Klimawandel; Krieg; Künstliche Intelligenz; Nachhaltigkeit; Nudging; Ökologie; Planetar; Plastizität; Plattform; Populismus; Postfaktisch; Posthumanismus; Resilienz; Situiertheit; Social Media; Tracking & Tracing; Unsicherheit; Update; Vulnerabilität.
Einige sind 2025 schon nicht mehr aktuell, da sie etwa Pandemie-bezogen sind. Das Postfaktische hat seit Donald Trumps zweiter Amtszeit eine neue Dimension gewonnen. Wo bleibt also der Trumpismus, wo MAGA, wo ist die Ampel, wo der Rechtsextremismus? Von NGOs, die von der Union bekämpft werden, ist sowenig die Rede wie vom Verbrenner-Aus oder dem Heizungsgesetz, das eine die vorgezogene Bundestagswahl mit entschieden hat.
Warum als Finanzierung als Lemma, aber keine eigenständige Auseinandersetzung mit „Kapitalismus“, wo doch Friedrich Merz „Mehr Kapitalismus wagen“ will? Warum „Postfaktisch„, doch kein Begriff, der digitale Verschwörungs-Ökonomien oder Desinformation explizit adressiert. Da bleibt schon einiges im Dunkeln.
Fazit: schöne Nostalgie, begrenzter Mehrwert
So ist Glossar der Gegenwart 2.0 eine gut gemachte, stellenweise kluge, insgesamt aber erstaunlich konventionelle Fortschreibung eines einst innovativen Projekts. Die „Gegenwart“ in 34 Begriffe zu bringen, ist ein bisschen größenwahnsinnig.
Wer das ursprüngliche Glossar der Gegenwart kennt, wird mit einer gewissen Nostalgie durch die neuen Lemmata blättern – von Achtsamkeit über Digitalisierung, Hass, Künstliche Intelligenz, Social Media bis Vulnerabilität. Doch der behauptete „niedrigschwellige Zugang zu zentralen Schlüsselbegriffen unserer Zeit“ und das Versprechen eines schärferen Verständnisses der Gegenwart bleiben in der Summe hinter der Rhetorik von Verlag und wohlwollenden Rezensionen zurück. Ein solches Buch kann man im Regal haben – brauchen muss man es nicht. Anders als andere Kritiker kann ich der Auswahl nicht so viel Positives abgewinnen. Aber Kritiken bleiben immer subjektiv.
Quod erat demonstrandum.
Das sind die Lemmata
Achtsamkeit; Agilität; Algorithmus; Ansteckung; Anthropozän; Biodiversität; Care; Dekolonisierung; Digitalisierung; Deskription; Diversität; Epigenetik; Finanzierung; Hass; Identitätspolitik; Klimawandel; Krieg; Künstliche Intelligenz; Nachhaltigkeit; Nudging; Ökologie; Planetar; Plastizität; Plattform; Populismus; Postfaktisch; Posthumanismus; Resilienz; Situiertheit; Social Media; Tracking & Tracing; Unsicherheit; Update; Vulnerabilität.
Armin König